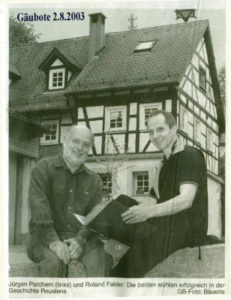Showing posts tagged as: Reusten
Ortskunde Reusten
Meine ortskundliche Führung durch Reusten am Samstag den 20. August 2022
Tagblatt Tübingen
 |
| Gäubote Herrenberg |
 |
Tagblatt 2022-08-20 Tübingen
Sensationsfunde und ungeklärte Fragen
Kennen sie Ammerbuch – Von Sophie Holzäpfel
Bei einem Spaziergang durch Reusten vermittelte Roland Fakler erschreckende, aber auch amüsante Einblicke in die Ortsgeschichte
Von den ersten Siedlungen bis zur NS-Zeit reichte der ortskundliche Spaziergang durch Reusten am Samstagnachmittag. „Dieses Dorf hat eine ungeheuer spannende Geschichte“, sagte Autor Roland Fakler zu Beginn des Rundgangs durch den zweitkleinsten Teilort von Ammerbuch. Rund 30 Interessierte begaben sich mit ihm auf historische Spurensuche.
Bei Grabungen auf dem Kirchberg, dem „Hausberg em Flägga“, so der ehemalige Ortsvorsteher Hans Sautter, wurden jungsteinzeitliche Siedlungen entdeckt. Die ältesten dieser Funde datieren 5000 vor Christus. Rund 30 Hockergräber, ein Schwert und der Rest eines Wollnashorns brachten die Ausgrabungen zutage. Der Reustener Jürgen Parchem zeigte Bilder der Funde. So gilt der Goldring, der 2020 in einem frühbronzezeitlichen Frauengrab entdeckt wurde, als „absoluter Sensationsfund”, sagte Parchem. Es handle sich dabei um das früheste sicher datierbare Goldobjekt im Südwesten.
Solche Funde geben Aufschluss über die Vergangenheit des Dorfes, das sich „im Fluss der Zeit“ befinde, so Fakler. Der Spaziergang führte die Gruppe über den Kirchberg zum „Reustener Sattel“, wo bis in die 1960er-Jahre in Steinbrüchen Kalkstein gebrochen wurde. Kalkstein sei damals nicht nur für Straßen und den Bau von Häusern verwendet worden, sondern in zermahlener Form auch als Dünger, erklärte Fakler. Bis heute gilt der 970-Einwohner-Ort als Selbstversorgerdorf. So gibt es außer einer Honig- und Milchtankstelle die „Metzgerei Egeler” und „den einzigen Michviehbauernhof im ganzen Ammertal“, den die Familie Gauss betreibt; außerdem den Bioladen, gegenüber der Kirche.
Beim ortskundlichen Spaziergang in Reusten mit Autor Roland Fakler ging es über den Ortskern hoch hinaus.
Über den Kochartgraben ging’s vorbei am einstigen Standort der „Burg Kräheneck“. Die frühmittelalterliche Höhenburg wurde zwischen 1000 und 1200 vermutlich als Stammsitz der Herren von Kräheneck genutzt. Die Ruine gibt Historikern bis heute Rätsel auf. „Wir wissen nicht, weshalb sie zerstört wurde“, sagte Fakler. Weiter ging es über den Friedhof zum „Kriegerdenkmal“, das im Herbst 1927 eingeweiht wurde. Das Denkmal erinnert nicht nur an die Reustener Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, sondern soll mahnen.
87 Prozent der Reustener hätten die NSDAP gewählt, so Fakler: „Drei junge charismatische Männer hatten ihren Anteil daran“. So hätten der damalige Ortsgruppenleiter, der Reustener Pfarrer und ein Lehrer mit der Partei sympathisiert. „Kriege sind keine unabwendbaren Naturereignisse, sondern werden von Menschen gemacht“, ist auf einer der Geschichtstafeln am Wegrand zu lesen. Fakler: „Wir müssen achtsam sein. Wir brauchen mündige Bürger.“ Er kritisierte, dass der Ortschaftsrat den Vorschlag, das Denkmal in „Friedensmahnmal“ umzubenennen, abgelehnt habe.
Über steile Treppenstufen ging es hinunter in den Ortskern. Der Spaziergang führte vorbei an der „Ackermann-Skulptur“, dem ehemaligen Waschhaus und dem 1855 errichteten Backhaus. Eine wichtige Station war außerdem die Kelterkirche. Die 1575 erbaute Kelter wurde knapp 200 Jahre später zur evangelischen Kirche umgebaut. Religionskritiker Roland Fakler betonte: „Wir brauchen Werte, die über der Religion stehen: Humanität und Demokratie!”
Vorbei ging’s noch am „Bergcafe“, das über die Grenzen Reustens hinaus bekannt ist. Seinen ersten Besuch dort vor über 40 Jahren werde er nie vergessen, so Fakler: „Ich hatte eine Auseinandersetzung mit der Cafe-Besitzerin Marie, weil ich an einem Sommertag nicht draußen sitzen wollte.“ Er habe die fehlenden Sonnenschirme bemängelt, woraufhin sich diese ereifert haben soll: „Mir hend welche ket, ond gäschd’ hend se hee gmacht!“ Die Erinnerung an die Schwestern Marie und Sophie, die damals das Cafe geführt haben, ließ einige Spaziergänger schmunzeln.
Gäubote Herrenberg
Unter der Ziege verbarg sich das Wollnashorn
Reusten: Roland Fakler taucht beim Ortsrundgang tief in die Geschichte des Dorfes ein. – Von Nadine Dürr
Auf der Breite, auf dem Wolfsberg und im alten Dorf leben heute die Reustener. Das jedoch war nicht immer so, wie Roland Fakler, Autor einer Reustener Ortschronik beim Dorfrundgang „Kennen Sie Ammerbuch?“ am vergangenen Samstag erzählte. Der Kirchberg war es, der die hauptsächlich vom Ackerbau lebenden Bandkeramiker vor rund 7000 Jahren nach Reusten lockte. Davon zeugen archäologische Funde wie Teile eines Langhauses oder ein Tragegefäß der Rössener-Kultur, das man in einem Frauengrab entdeckte. “Die Bandkeramiker hatten eine dunkle Hautfarbe, schwarze Haare und schwarze Augen. Sie glaubten wohl an eine Wiedergeburt. Daher die Grabbeigaben“, erklärte Jürgen Parchem, der die Grabungen als ehrenamtlich tätiger Verbindungsmann zwischen den Landwirten und dem Denkmalamt begleitet. Doch die auf dem Kirchberg gefundenen Spuren reichen noch weiter in die Vergangenheit zurück: Bei den Arbeiten an einer bronzezeitlichen Nekropole an den Hockergräbern fand man, so Parchem, eine Ziege und darunter: ein Stück Wollnashorn aus der Altsteinzeit!
Ehe sich die Spaziergänger vom Parkplatz am Berghaus zur nächsten Station aufmachten, merkte der ehemalige Ortsvorsteher Hans Sautter noch etwas zur jüngeren Geschichte an: „Der Flugplatz Hailfingen – Tailfingen hatte Einfluss bis hierher. Hier stand im Krieg ein riesiger Scheinwerfer und eine Vierlingsflak.“ Auch die auf dem Reustener Sattel stehende Kaiserlinde hatte ihren Ursprung in einem Krieg, wie Fakler weiß: Nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich hatte man den Baum zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs gepflanzt. „Die Linde“, führte der ortskundige Reustener aus, „erlebte ein Drama, als die Gemeinde sie 1997 fällen wollte”. 4000 Unterstützer unterschrieben die Petition einer Bürgerinitiative, die den Baum erhalten wollte. Tatsächlich habe dieser die Stürme Lothar und Wiebke überlebt, fand 2005 dann allerdings doch sein jähes Ende, als die Schäden überhandnahmen. „Es bilden sich aber schon vier neue Stämme, und einer wird die neue Kaiserlinde werden“, stellte Fakler in Aussicht.
Ebenfalls nicht aus dem Dörfchen wegzudenken ist das nahe gelegene Bergcafe. Seine erste Begegnung mit dem berühmten Wirtinnen-Duo Marie und Sophie vor 40 Jahren schilderte Fakler in aller Ehrfurcht. Erdreistet habe er sich seinerzeit, den beiden Schwestern die Anschaffung von Sonnenschirmen für die Terrasse ans Herz zu legen, woraufhin ein verbales Donnerwetter auf ihn einprasselte. Umgehend habe er den beiden Frauen die Friedenspfeife gereicht und in der Causa „Sonnenschirme“ sei man übereingekommen: „D Gäscht hend se hee gmacht, d Gäscht solleds biaßa.” Bekannt war Reusten überdies für den Abbau von Kalkstein im Tagebau. „Es gab”, erzählte Fakler, „vier bis fünf Steinbrüche, der letzte wurde 1968 geschlossen.” Wälle hätten die jungsteinzeitlichen Siedler damit gebaut, zudem diente das Sedimentgestein als Dünger und zum Bau von Kellern. Vorbei an den Bäumen, die die Gemeinde auf dem Kirchberg für die im Krieg vermissten und gefallenen Soldaten gepflanzt hatte, ging es zum Platz der ehemaligen Burg Kräheneck. „Wir wissen nicht, wer sie baute und zerstörte“, berichtete Fakler. Es muss jedoch in der Zeit um 1000 bis 1200 gewesen sein, als die Zungenburg den Hügel zierte. Genutzt worden, so Fakler, sei sie wohl an Gerichtstagen zur Unterkunft und Verpflegung. In der Zeit des Nationalsozialismus habe man den Ort dann auf den Namen Adolf-Hitler-Platz getauft und bis heute nicht umbenannt. „Man sieht da auch noch einen Ständer aus der glorreichen Zeit“, ergänzte Fakler spöttelnd. „Er wurde so tief einbetoniert, dass er mindestens 1000 Jahre lang hält“.
Am Friedhof angekommen, galoppierte der Autor der Reustener Ortschronik dann durch die Geschichte – von der Kelten- über die Römerzeit bis hin zu den Alemannen, die dem Dorf Reusten seinen Namen gaben. Die Grafen von Nagold – später: Tübingen – verkauften den Flecken dann 1293 an das Kloster Bebenhausen, das jahrhundertelang als Dorfherr fungieren sollte. Mit der Übergabe Reustens an die Grafen von Württemberg wurden die Dorfbewohner schließlich evangelisch.
Bitter dann der Dreißigjährige Krieg: 45 von 85 Reustener Wehrpflichtigen fielen. Auch in den beiden Weltkriegen zahlte das Dorf ,laut Fakler, einen hohen Tribut. Wohl aufgestachelt von drei charismatischen Reustenern, darunter der Lehrer und der Pfarrer, nahm das Unglück seinen Lauf. „87 Prozent wählten in Reusten die NSDAP”, wusste der nun am Kriegerdenkmal angekommene Ortshistoriker. Das Mahnmal in ein Friedensdenkmal umzubenennen, sei am Ortschaftsrat gescheitert. Jürgen Parchem jedoch hat die Grabsteine zweier qualvoll im Lazarett gestorbenen Soldaten nahe dem Denkmal aufgestellt. Dem Mythos, dass alle Gefallenen „auf dem süßen Felde der Ehre starben“, will er damit etwas entgegensetzen.
Vorbei am Waag-, Wasch- und Backhäusle ging es zum Schluss zur evangelischen Kirche, eine ehemalige Kelter, die, nachdem das Gotteshaus auf dem Kirchberg verfallen war, umfunktioniert wurde. Die beiden stillgelegten Reustener Mühlen konnten die Spaziergänger nicht mehr besichtigen. Reinhold Bauer, einst Müllersknecht bei der Mühle Schill, erzählte abschließend jedoch farbenfroh von den nach Reusten gebannten Hailfingern und Tailfingern und der vom Müller eingezogenen Milter.
Dieses Buch gibt einen Überblick über Reusten, einem malerischen Dorf in der Gemeinde Ammerbuch, Kreis Tübingen. Vor allem geht es darum, seine interessante Geschichte zusammenhängend, übersichtlich und verständlich darzustellen, von den jungsteinzeitlichen Funden auf dem Kirchberg, bis zu den Ereignissen, die die Bewohner im Jahr 2020 bewegen.
Mein Buch
Reusten und seine Geschichte
DINA5 136 Seiten 80 Bilder 26 farbige Seiten
Herstellung und Verlag:
Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN-13: 978-3-8370-4383-9
im Buchhandel (14 Euro) erhältlich.
Zehntscheuer ist an die 450 Jahre alt
Bericht im Gäuboten Herrenberg am 6.10.2015
Donnerstag, 8. Oktober2015 – Lokales Gäubote 2015-10-06
Zehntscheuer ist an die 450 Jahre alt
Reusten: Mit dem Richtfest ist ein weiterer Schritt Richtung Kultur- und Veranstaltungsscheuer gemacht.
Die Spatzen pfeifen es seit geraumer Zeit vom Dach: Die Reustener Zehntscheuer hat mehr Jahre auf dem Buckel als vormals angenommen – jetzt ist es amtlich. Eine sogenannte dendrochronologische Untersuchung des Holzgebälks im Dach der Scheuer förderte das wahre Alter der betagten „Dame” zutage. So fügte sich beim Richtfest ein weiteres historisches Puzzleteil zu den anderen hinzu.
Von Rüdiger Schwarz
Ohne Moos nix los, „hirnen” lohnt sich. Nachdem die Führungsriege des 2013 ins Leben gerufenen Fördervereins der Reustener Zehntscheuer ein Konzept auf die Beine stellte, lässt sich der Ammerbucher Gemeinderat nicht lange bitten. Er stellt für Instandsetzung und Sanierung des imposanten Gebäudes 200 000 Euro in den Haushalt ein. Im März dieses Jahres knallt bei den Mitgliedern des Vereins vermutlich nicht nur ein Sektkorken. Weitere Fördergelder füllen den Topf. Das Land zeigt sich in Spendierlaune, lässt für das Projekt noch einmal rund 105 000 Euro springen. Eine Finanzspritze aus dem Förderprogramm „Entwicklung ländlicher Raum”. Also frisch ans Werk gemacht.
Erst einmal heißt es: Däumchendrehen. Warten auf die Baugenehmigung. Anfang August ist es dann so weit, es kann aufgerüstet werden. Im Visier: das Dach, morsche Balken, ein maroder Flickenteppich aus nicht mehr ganz taufrischen Ziegeln. Unverhofft kommt oft: Auf einmal hält man einen historischen Schatz in Händen. Denn nicht wenige der Dachziegel stammen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aus der Entstehungszeit der Zehntscheuer. Es sind handgestrichene Biberschwanzziegel. Ehedem ziehen die Ziegler mit ihren bloßen Fingern die Wasserrillen in den Lehm der noch nicht gebrannten Ziegel. Über die Rinnen soll das Wasser abfließen. Erst in den 1880er Jahren nimmt die industrielle Massenfertigung von Dachziegeln Fahrt auf. Unter den rund 9 000 originalen Dachplatten tummeln sich einige Zierziegel, auch bekannt als Feierabendziegel.
Von 9 000 historischen Biberschwanzziegeln bleiben 7 000 übrig.
Vielleicht ein Abwehrzauber?
Auf einem ist eine kleine, feine Rose in den noch nicht getrockneten Lehm eines Ziegels eingedrückt worden. Strahlenmotive werden mitunter als Hexenbesen gedeutet. „Es könnte sich um einen Abwehrzauber handeln”, vermutet Ortshistoriker Roland Fakler. Ab dem 16. Jahrhundert blüht der auf die Römer zurückgehende Brauch, Ziegel mit grafischen Elementen zu verzieren, wieder auf. Nach vollendetem Tageswerk, mit bis zu 1 000 gestrichenen Ziegeln, verewigt sich so mancher Ziegler noch über eine Art Graffiti auf einem der hergestellten Stücke. Zumeist wohl aus purer Lust am Gestalten heraus.
Doch wo stammen die Biberschwanzplatten her?
In einer Beschreibung des Herrenberger Oberamts aus dem Jahre 1855 werden in Reusten neben drei Lehmgruben auch zwei bestehende Ziegeleien erwähnt. Es liegt nahe, dass die Ziegel vor Ort gefertigt wurden. Um sicherzugehen, müsste man Proben aus den ehemaligen Gruben mit dem Material der Ziegel abgleichen. So ein Schatz auf dem Dach lässt nicht nur das Herz von Bauhistorikern höher schalgen. Bereitet jedoch die eine oder andere schlaflose Nacht. Was tun? Ab in den Bauschuttcontainer oder erhalten? Die Verantwortlichen des Fördervereins entschieden sich fürs Draufpacken. Allerdings nur auf der nördlichen Vorderseite. Auf die Südseite wandern ausschließlich nagelneue, maschinell produzierte Dachplatten. „Jeder der alten Ziegel, die jetzt wieder auf dem Dach sind, ist zehnmal durch die Hände einer Person gegangen”, merkt Martin Held an. Kein Wunder, müssen die Kleinode doch Stück um Stück abgenommen, auf Zustand geprüft, zwischengelagert, erneut hochgeschafft werden. 7 000 der historischen Stücke hievt man nach oben, 2 000 werden aussortiert.
Reusten gehörte zu Bebenhausen
Mit der Zehntscheuer geht man auf Zeitreise. Die führt mitten hinein ins 16. Jahrhundert. Das Kloster Bebenhausen, ehemaliger Herr des Dorfes, wird im Zuge der Reformation aufgelöst. Längst sind die Herzöge von Württemberg die neuen Herren, denen die Bewohner des Dorfes den Zehnten abzutreten haben. Eine Naturaliensteuer, für die etwa Getreide, Wein, Feldfrüchte oder Öl herhalten. Nun kommt die Zehntscheuer als Lager mit ins Spiel. Jetzt steht fest, dass das 30 Meter lange, bis zu 15 Meter hohe, 300 Quatratmeter goße Gebäude in einem Aufwasch mit der herrschaftlichen Weinkelter hochgezogen wurde. Die Untersuchungen ergaben, dass die Bäume für das Dachgebälk der Scheuer im Winter 1573 gefällt wurden. “Bis zum Verbau lagerte das Holz dann in der Regel noch ein Jahr”, weiß der Vorsitzende des Fördervereins, Jürgen Parchem.
Die 1575 erbaute Kelter wird 1760 zur Kirche umfunktioniert. Der emsig betriebene Weinanbau liegt seit Anfang des 19. Jahrhunderts am Boden. Warum ist die Zehntscheuer nun eigentlich so riesig ausgefallen? „Der Zehnte war eine progressive Steuer. Bei guten, ertragreichen Äckern mussten die Bauern bis zu 20 Prozent ihrer Ernte abliefern. Und Reusten hat fruchtbare Böden”, weiß Parchem. Während so einer Erntezeit hielt eigens angeheuertes Wachpersonal an der Mauer des Zehnthofes die Stellung. Plünderungen durch notleidende Menschen soll ein Riegel vorgeschoben werden.
Signalfarbe für öffentliche Gebäude
Nebenbei ist die „beige” Optik der Scheuer alles andere als dem Zufall geschuldet. Das ist der Originalfarbton. Im 16. Jahrhundert waren die meisten Leute noch Analphabeten. Daher wurden öffentliche Gebäude mit ganz bestimmten Signalfarben markiert”, sagt der Vorsitzende.
Vandalismus am Thingplatz
Bericht im Tagblatt am 26.08.2015

Vandalismus am Thingplatz
Reusten. Roland Fakler traute seinen Augen nicht. Als der Hobbyhistoriker kürzlich von Reusten mit dem Fahrrad Richtung Entringen fuhr, passierte er auch eine Station des Geschichtspfades, den er gemeinsam mit Reustens zweitem Ortschronisten Jürgen Parchem vor ein paar Jahren ausgewiesen hat. Etwa 500 Meter nach dem Wolfsberg verweist am Radweg nach Entringen eine Aluminiumtafel auf den ehemaligen Gerichts- und Hinrichtungsplatz, der sich dort nachweislich zwischen 1140 und 1336 befunden hat und wahrscheinlich bereits von den Germanen als Thingplatz genutzt wurde. Die von Fakler selbst gestaltete Tafel, immerhin einen Zentimeter dick, wurde zerstört. „Die hat jemand mutwillig zusammengeknickt”, sagt Fakler. „Wer macht so was?”, fragt sich der Ortshistoriker, der solchen „Vandalismus nicht verstehen” kann. Um die „Sache aufzuklären”, will Roland Fakler jetzt Anzeige bei der Polizei erstatten, uha / Bild: Fakler
Leider war das nicht der einzige Anschlag auf eine der sechs Geschichtstafeln, die im Dorf verteilt sind. Bei der Tafel auf dem Friedhof am Kriegerdenkmal störte sich ein Leser an dem Wort “Friedensmahnmal” und hat versucht, es mit dem Messer herauszuschneiden, auch das Wort “Kelterkirche” missfiel ihm offensichtlich und schnitt es ebenfalls mit dem Messer heraus.
Die Tafel, die auf Burg Kräheneck verweist, wurde offensichtlich mit einem schweren Gegenstand von Hinten attackiert.
Was sollte man von solchen Zeitgenossen halten, die ehrenamtliche Arbeit mit solchem Vandalismus quittieren? Es ist einfach nur traurig!
Siehe Geschichtspfad Ammerbuch – Reusten
Die Stationen sind:
| Auf dem Kirchberg | Kaiserlinde – Jungsteinzeitliche Funde |
| Am Radweg nach Entringen | Gerichtsplatz an der Römerstrasse |
| Auf dem Kirchberg | Kriegerdenkmal / Bergkirche |
| Auf dem Kirchberg | Burg Kräheneck |
| Parkplatz am Hardtwald | Betteleiche |
| noch immer nicht aufgestellt | Kelterkirche – Zehntscheuer – Backhaus |
Schöne Aussicht unter dem Galgen runter ins Tal
Schöne Aussicht unter dem Galgen runter ins Tal
Gäubote Herrenberg
2004_09_08
Von Birgit Spies
Ammerbuch-Reusten – Fertig gestellt und der Öffentlichkeit präsentiert wurde jetzt die zweite Station des Reustener Geschichtspfads: eine massive, hölzerne Bank rund um die ( “neue”) Betteleiche und eine Schau-Tafel, die mit ihrer Beschriftung und einer Fotografie an die alte Betteleiche erinnert.
Die neue Betteleiche am Eingang zum Reustener Hardtwald ist nun auch schon etwa 70 Jahre alt. Sie steht in unmittelbarer Nähe zum großen Stumpf der ursprünglichen Betteleiche, die in den 70er Jahren von einem Sturm gefällt wurde. Jetzt wurde der Platz zwischen diesen beiden Bäumen gestaltet und mit Ansprachen und einem Umtrunk der Gemeinde und der Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben.
Für die Bank dankte Ortsvorsteherin Christel Halm dem Reustener “Rentner-Team”, das das wieder einmal bewerkstelligt hatte, nachdem es schon bei der Sanierung des Backhauses mit Hand angelegt hatte. Ortschaftsrat Willi Schill hatte die Anregung gegeben: “Machet doch wieder eine Bank um die Eiche.” Alfred Dessecker, Alois Holzner und Egon Koch folgten ihr, gemeinsam fertigten sie die sechseckige, massive Holzbank, die nun die “neue” Betteleiche schmückt und zum Verweilen einlädt. Halm: “Mit diesen Kerle kann man den Flecken umtreiben.”
Aber auch Halm selbst erhielt Dank und zwar von Jürgen Parchem vom Reustener Geschichtsverein, der ihr Blumen überreichte und deutlich machte, wie wichtig es war, dass Halm die Gruppe unterstützte und auch das Archiv geöffnet hatte. Einst hatte Halms Schwiegervater Hans Halm dieses Archiv ordnen lassen, was “schon ein bissle Geld gekostet habe”, heute sei man dankbar dafür.
Denn gefunden hat man darin in der Ortschronik des Lehrers Paul Gros von 1932 eine Fotografie der alten Betteleiche und ein Gedicht, das die Aussicht preist, die man von ihrem Platz aus genießen kann, über “die Wiesen im Ammertal” bis hin zur Wurmlinger Kapelle und zum Albbrand. Und schließlich fand man auch einen alten Bericht des “Gäubote” von 1905. Dieser zeigt, dass der Platz an der Reustener Betteleiche einst auch ein Treff- und Sammelpunkt des “fahrenden Volks” der Zigeuner war.
Alles das ist auf der Schau-Tafel zu sehen und wurde von Roland Fakler erläutert, der zudem, bevor abschließend Freibier an das auf den aufgestellten Bierzeltbänken sitzende Publikum ausgeschenkt wurde, vier mögliche Bedeutungen der Benennung “Betteleiche” vorstellte.

“Wer sich etwa an einem schönen Abend auf die hübsche Bank an der Betteleiche setzt und von diesem Ort aus in das Land schaut, dessen Herz wird reich und wenn es gleich bettelarm ist.
Der Ausblick von hier ist noch köstlicher als der von der Schulmeisterbuche, weil er auch an die ferne Dämmerung der Schwarzwaldhöhen streift und ein gar lebhaftes Geländewellenwogen trifft, das hübsch ausgeglichen, wundersam anspricht.
Zur Linken schreiten die stattlichen Schönbuchausläufer nahe an das Ammertal heran und heben in würdiger Haltung die Kleinodien Hohenentringen und Roseck in die sonnenverklärte Landschaft.
Geradeaus gegen Südosten schwimmt die Wurmlinger Kapelle in wohltuender Seelenruhe über dem Wellengekräusel der Landschaft.
Im Hintergrunde aber steigert sich die Lebhaftigkeit des Landschaftsbildes in der Wucht der Albkette zur Majestät. Wer die meisterhafte Linienführung der Albkette und vor allem die berückende Form mancher Albriesen einmal gründlich betrachten will, der setze sich einige Zeit auf die Bank an der Betteleiche.
Wie ein Wunder, anders kann ich es nicht sagen, zieht es da an seinen Augen vorüber. Die letzten Strahlen der heimkehrenden Sonne, welche in goldenem Geleuchte über den Schwarzwaldhöhen aufjubelt, fallen an die Stirnen der Albberge, und die weiten Dächer der Buchenwälder dort glänzen wie Kupfer.
Aus dem Tannenwald bei Oberndorf rücken schwere Schatten.
Über Tübingen glüht eine Fensterscheibe im Abendsonnenschein.
Die Wiesen im Ammertal legen sich in die kühlen Schatten des Abends.
Die Wurmlinger Kapelle aber spricht das Abendgebet.”
Der Reustener Recycling-Turm
Der Reustener Recycling-Turm
Dorfhistoriker glauben, dass der Turm der Kelterkirche vom Berg stammt
Tagblatt 2004_07_10
Mario Beißwenger
 1705 malte der Kartograph Stierlin diesen schematischen Blick auf Reusten. Die Bergkirche hat dabei ein Kirchturmdach ganz ähnlich wie die erst 1760 eingeweihte heutige Kelterkirche im Tal. Schwer zu erkennen – im Falz der Karte – ist ein Wehrturm, dessen Reste wohl erst vor kurzem beseitigt wurden.
1705 malte der Kartograph Stierlin diesen schematischen Blick auf Reusten. Die Bergkirche hat dabei ein Kirchturmdach ganz ähnlich wie die erst 1760 eingeweihte heutige Kelterkirche im Tal. Schwer zu erkennen – im Falz der Karte – ist ein Wehrturm, dessen Reste wohl erst vor kurzem beseitigt wurden.
(Inzwischen wissen wir dass Stierlin eine Karte aus dem Jahr 1605 kopiert hat. )
REUSTEN (bei). Die Kirchengemeinde Reusten macht am Sonntag ihre Hocketse und verabschiedet die langjährige Mesnerin Ursula Bühler. Festbesucher können bei dieser Gelegenheit auch erfahren, woher der Turm der Kirche kommt.
Dass die Kirchengemeinde feiert, nehmen Jürgen Parchem und Roland Fakler zum Anlass, ihre jüngsten Forschungen zur Lokalgeschichte vorzustellen. Die Hobby-Historiker glauben Belege dafür zu haben, dass der Turm der Reustener Kelter-Kirche recycelt ist. Vorher soll er die Kirche auf dem Bergfriedhof geziert haben.
Dann inspizierten die Ortshistoriker zusammen mit Mesnerin Ursula Bühler noch den Dachstuhl. Für Fakler finden sich dort ganz eindeutige Spuren: “Dieser Turm wurde schon mal benutzt.” Zu Zeiten als Baumaterial noch kostbar war, wurden Balken und Mauersteine immer wieder verwendet. Es ist also wahrscheinlich, dass auch die Reustener gespart haben, als die Kirche Ende des 18. Jahrhunderts ins Dorf, in die vorherige Kelter verlegt wurde. Dabei könnten sie auch die Konstruktion übernommen haben.
“Die haben das damals ja gar nicht lesen können”, empört sich Fakler. Damit sich das nicht wiederholt hat er sein Schullatein entstaubt und den Inhalt für heutige Kirchgänger übersetzt.
Und dann entdeckten Fakler und Parchem auch noch einen früheren Wehrturm. Kurz vor dem Abriss! Ihrer Meinung nach steckte der Sockel des Gebäudes in der jüngst abgebrochenen Scheuer in der Altinger Straße. Die Hinweise darauf waren ganz eindeutig. Im älteren Gemäuerteil der Scheuer waren nämlich Schießscharten.
INFO Die Hocketse bei der Reustener Kirche beginnt mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr. Dann wird mit Speisen, Getränken und Spielen für Kinder unterhalten. Wer Geld für eine Versteigerung nach amerikanischer Art mitbringt, hilft zusätzlich die Kasse der Kirchengemeinde aufzubessern, die eine neue WC-Anlage bauen will.
Kleindenkmale in Ammerbuch
Kleindenkmale in Ammerbuch (4): Reusten
2003_08_30 Tagblatt
 Hier führt schon lange kein Weg mehr in den Reustener Friedhof. Roland Fakler und Jürgen Parchem haben in Archiven gesucht, bis sie herausfanden, wann der frühere Haupteingang zum Reustener Friedhof (im Bild) zugemauert wurde. Ihrer Meinung nach war es 1890. Auf einem Katasterplan von 1830 ist der Zugang noch an der heute versperrten Stelle, 1841 verzeichnet ein Zeitungsartikel größere Arbeiten am Friedhof. Am Schloss des Friedhofstores finden Eingeweihte das Datum 1890 eingestanzt. Verschlossen wurde der Torbogen auf der dem Dorf zugewandten Mauer auch mit zwei Grabsteinen. Der Linke erinnert an eine Wöchnerin, die samt Kind verstarb, der rechte an einen Pfarrer. “Verziert waren sie mit den für die Romantik typischen Sinnsprüchen”, sagt Parchem. Nur leider kann sie der Betrachter nicht mehr lesen, vor fünf Jahren sei das noch möglich gewesen. Inzwischen schilfert die Sandsteinoberfläche ab. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich auch um die Kleindenkmale zu kümmern, wenn ihre Botschaften überdauern sollen. Die Lokalhistorikcr vermuten, dass in der Torbogenfüllung auch Steine der früher im Friedhof befindlichen Eligius-Kirche stecken. Das um 1300 erstellte Gotteshaus wurde schon 1760 durch die heutige Dorfkirche, eine ehemalige Kelter, ersetzt. Solche Geschichten lassen sich mit kleinen denkmalwürdigen Hinterlassenschaften belegen. Der Reustener Kirchberg ist übersäht mit historischen Spuren, zu denen auch der 1933 einzementierte Fahnenständer gehört, um den die Nazis Sonnwendfeiern zelebrierten. Interessante Kleindenkmale lassen sich auch anderswo entdecken. Im Hardtwald stießen die Hobbyhistoriker nach einem Tipp eines alten Reusteners auf einen Grenzweg. “Allein hätten wir den nie gefunden”, sagt Fakler. Wo der Weg verläuft, verraten sie nicht: er muss erst noch erfasst werden.
Hier führt schon lange kein Weg mehr in den Reustener Friedhof. Roland Fakler und Jürgen Parchem haben in Archiven gesucht, bis sie herausfanden, wann der frühere Haupteingang zum Reustener Friedhof (im Bild) zugemauert wurde. Ihrer Meinung nach war es 1890. Auf einem Katasterplan von 1830 ist der Zugang noch an der heute versperrten Stelle, 1841 verzeichnet ein Zeitungsartikel größere Arbeiten am Friedhof. Am Schloss des Friedhofstores finden Eingeweihte das Datum 1890 eingestanzt. Verschlossen wurde der Torbogen auf der dem Dorf zugewandten Mauer auch mit zwei Grabsteinen. Der Linke erinnert an eine Wöchnerin, die samt Kind verstarb, der rechte an einen Pfarrer. “Verziert waren sie mit den für die Romantik typischen Sinnsprüchen”, sagt Parchem. Nur leider kann sie der Betrachter nicht mehr lesen, vor fünf Jahren sei das noch möglich gewesen. Inzwischen schilfert die Sandsteinoberfläche ab. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich auch um die Kleindenkmale zu kümmern, wenn ihre Botschaften überdauern sollen. Die Lokalhistorikcr vermuten, dass in der Torbogenfüllung auch Steine der früher im Friedhof befindlichen Eligius-Kirche stecken. Das um 1300 erstellte Gotteshaus wurde schon 1760 durch die heutige Dorfkirche, eine ehemalige Kelter, ersetzt. Solche Geschichten lassen sich mit kleinen denkmalwürdigen Hinterlassenschaften belegen. Der Reustener Kirchberg ist übersäht mit historischen Spuren, zu denen auch der 1933 einzementierte Fahnenständer gehört, um den die Nazis Sonnwendfeiern zelebrierten. Interessante Kleindenkmale lassen sich auch anderswo entdecken. Im Hardtwald stießen die Hobbyhistoriker nach einem Tipp eines alten Reusteners auf einen Grenzweg. “Allein hätten wir den nie gefunden”, sagt Fakler. Wo der Weg verläuft, verraten sie nicht: er muss erst noch erfasst werden.
INFO Wer bei der Ammerbuch weiten Erfassung von Kleindenkmalen mitmachen will und von weiteren historisch interessanten Objekten auf Reustener Markung weiß, kann das Roland Fakler oder Jürgen Parchem mitteilen.
Proletarier und Privatgelehrter
Proletarier und Privatgelehrter
Jürgen Parchem und Roland Fakler: Auf der Spur Reustener Geschichte und Geschichten
Gäubote Herrenberg
2. August 2003
Jürgen Parchem und Roland Fakler
Foto: Bäuerle
Ammerbuch Reusten: Sie bezeichnen sich selbst als “der Proletarier und der Privatgelehrte”. Getränkekaufmann Jürgen Parchem und Künstler Roland Fakler sind in der Tat ein ungleiches Paar. Eine gemeinsame Passion jedoch eint das ungewöhnliche Gespann: Das Interesse an der Geschichte ihres Heimatortes Reusten ist es, das die beiden Männer zu Verbündeten macht.
Erstaunlicherweise stammt jedoch keiner der beiden Hobbyhistoriker gebürtig aus Reusten. Genau diese Tatsache hat Jürgen Parchem und Roland Fakler aber schließlich dazu gebracht, sich mit der Geschichte des Kleinods an der Ammer zu beschäftigen. “Als ich vor 27 Jahren nach Reusten gezogen bin, habe ich mir immer ein Buch über die Geschichte des Ortes gewünscht”, erzählt der 50 jährige Künstler. Um sich selbst und künftigen Neubürgern diesen Wunsch zu erfüllen, hat Fakler in den letzten Jahren Bücher gewälzt und Recherchen betrieben. Die Ergebnisse seiner Arbeit hat er in seinem Buch “Reusten und seine Geschichte” zusammengefasst.
Jürgen Parchems Motivation, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, ist eine andere: Die familiären Wurzeln des 47 Jährigen führen nach Polen, über seine geschichtliche Herkunft konnte Parchem nur wenig herausfinden. Dass sich viele Menschen kaum für ihre Vorfahren interessieren, kann der Getränkehändler nicht verstehen: “Es tut mir weh, dass Leute, die die Möglichkeit dazu haben, etwas über ihre Vorfahren herauszufinden, gar kein Interesse daran haben.” Als Vorreiter will er den Reustenern ein Beispiel geben, wie spannend es sein kann, tief in die Geschichte der eigenen Heimat einzutauchen. “Wir können stolz sein auf unsere Tradition, doch leider ist unsere Gesellschaft schon viel zu amerikanisiert”, bedauert der passionierte Hobbyhistoriker. Sein Anliegen ist es, seinen Mitbürgern “Selbstverständnis vor der Haustüre” zu geben. Ein praktisches Beispiel lebendiger Geschichte hat Jürgen Parchem eigenhändig und im Schweiße seines Angesichts abgegeben. Von 1984 bis 1996 renovierte er ein rund 240 Jahre altes Fachwerkhaus in der Wintergasse. Aus einer verwahrlosten Ruine hat Parchem ein Schmuckstück gezaubert, das die Blicke auf sich zieht. Von den architektonischen Entwürfen über den Ausbau des Dachstuhls bis hin zur Fachwerk Restauration Jürgen Parchem hat fast alles in Eigenregie bewältigt. Für das Geld, das der Reustener in den Ausbau gesteckt hat, bekommt man im Regelfall nicht einmal eine Eigentumswohnung. Man muss also kein Millionär sein, um sich ein derartiges Domizil zu schaffen: “Ich möchte auch jungen Leuten den Ansporn geben, so etwas einem Neubau vorzuziehen”, erklärt Jürgen Parchem.
Zwei sich ergänzende Ansätze
Der Proletarier und der Privatgelehrte, der Praktiker und der Theoretiker. Während sich Roland Fakler gerne ins Studium alter Chroniken vertieft, packt Jürgen Parchem gerne selbst an und baut so eine sichtbare Brücke “von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft”. Zwei Ansätze, die sich trotz allem nicht widersprechen, sondern vielmehr ergänzen. Einig ist sich das Gespann darin, dass sie die Geschichte “von unten” her aufarbeiten möchten: “Wir wollen nicht die Geschichte der Aristokratie, sondern die der einfachen Leute aufklären”, erläutert Jürgen Parchem. Konventionelle Geschichtsbücher seien oft zu sehr dem Adel und dem Klerus verpflichtet, Reusten aber ist seit jeher ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Davon zeugen viele Kleindenkmale wie Feldkreuze, Gedenk-, Kilometer und Grenzsteine. Seit ein paar Wochen mischt sich daher ein weiteres Projekt unter die geschichtlichen Recherchen der Hobbyhistoriker. Parchem und Fakler dokumentieren solche Kleindenkmale in Wort und Bild für das Landesdenkmalamt, um die steinernen Zeitzeugen vor dem Vergessen und der Zerstörung zu bewahren. Die beiden Herren spüren Gerüchten nach, räumen mit Vorurteilen auf oder bestätigen die eine oder andere Legende. Farbig, schillernd, detailverliebt: Stoßen Parchem und Fakler auf ein interessantes Faktum, schwingt sich ihre Fantasie empor. Bis 1765 habe es unter der Regentschaft Herzog Carl Eugens den “Frauenzechtag” gegeben, an dem sich die Reustener Bürgerinnen einmal im Jahr an den herzoglichen Tropfen aus den Weinbergen um Reusten gütlich tun durften. Dann wurde das Privileg abgeschafft. Ein Jahr später ging das Rathaus in Flammen auf. Hier erwacht Jürgen Parchem’s kriminalistisches Interesse: Haben die Frauen aus Rache den Brand gelegt? Ob nun Vermutung oder heiße Spur, Stoff genug für einen Roman liefert die These allemal.
- Die Kleindenkmale, die Jürgen Parchem und Roland Fakler gemeinsam dokumentieren, befinden sich oft außerhalb des Heimatortes und sind schwer zu finden. Daher sind die Hobbyhistoriker auf das Wissen und die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen.
- Hinweise nehmen Jürgen Parchem, Telefon (0 70 73) 24 27, und Roland Fakler, E-Mail rolandfakler@gmx.de. entgegen.
Wie hat’s van Gogh gemacht?
Wie hat’s van Gogh gemacht?
Der Privatgelehrte Roland Fakler schreibt zweimal über das Ammertal
Tagblatt / Südwest Presse 16.10.2001
Von
Kurt Oesterle
 Roland Fakler, der Individualist, freischaffende Künstler und Heimatforscher,
Roland Fakler, der Individualist, freischaffende Künstler und Heimatforscher,
hat jüngst ein Bilderbuch über die Gemeinde Ammerbuch veröffentlicht. Bild: Metz
REUSTEN. Seine Werke nennt er “Bilderbücher”. Damit man gleich heraushört, dass sie auch für Kinder geeignet sind. Das erste war Reusten und seiner Geschichte gewidmet, das zweite der Gesamtgemeinde Ammerbuch. Es kann seit kurzem erworben werden.
Verlegt hat die beiden Ammerbuch-Bücher derjenige, der sie auch geschrieben hat: Roland Fakler, 48. Der gebürtige Leutkircher wohnt in der Reustener Wolfsbergsiedlung, in einer hellen Gartenwohnung, in der er auch arbeitet. Von seinen Werken hat er nur wenige auf Vorrat, “höchstens zehn”. Wenn darüber hinaus eines gewünscht wird, setzt er sich an seinen Computer und druckt es aus. Außerdem liegen sie in kleinen Mengen an zwei Orten in Reusten auf Halde: im Bergcafe und im Bio-Laden. Im Bergcafe ist es Fakler zu seinem großen Stolz sogar schon gelungen sein älteres Reusten-Buch “an einen Berliner zu verkaufen”.
Immerhin: Hundert Exemplare von seinem “Bilderbuch Ammerbuch” hat er bereits losgeschlagen und zwanzig verschenkt. Wer es mit seinen Texten, Karten und Bildern erstehen will, muss 14 Euro anlegen. Dann besitzt er eine Art Handbuch der Gesamtgemeinde Ammerbuch, mit Auskünften zu jeder der einzelnen Mitgliedsgemeinden, zu Klima, Kultur, Neubaugebieten, Ortswappen, Bodenschätzen, Gewerbegebieten und Vereinen. Im Anhang finden sich wichtige Adressen und Telefonnummern, ebenso eine Liste der Gaststätten und eine mit allen Gemeinderäten samt politischer Zugehörigkeit. Den Schluss ziert ein “Ammerbuchrätsel” – das so leicht gar nicht zu lösen ist: Auf einem Foto sieht man acht Kirchtürme vor sich und soll sie nun ihrer jeweiligen Heimatgemeinde zuordnen; der Gast aus Tübingen hat immerhin vier geschafft.
Das einfach und handlich gemachte Buch mit seinen knapp hundert Seiten ist also Ortsporträt, Gemeindeführer und Sympathiewerbung in einem. Denn Fakler liebt sein Ammertal fühlbar und möchte es den Einheimischen nahe halten, sowie den Zugezogenen nahe bringen.
Zugezogen ist er einst selbst. Nachdem er in Tübingen ein kurzes, nur einsemestriges Medizinstudium abgebrochen hatte. “Ich wollte Schriftsteller werden, außerdem war mir Tübingen zu laut.” Er radelte los, geriet ins Ammertal und blieb. Das war vor einem Vierteljahrhundert. Gelebt hat Fakler stets in Reusten. Hier ist er heimisch geworden. Hat Freunde gefunden. Und Gesprächspartner, die ihm allerhand Buntes aus der Dorfgeschichte erzählen konnten. Den Rest erarbeitete er sich im Selbststudium. Etwa die Geschichte der Alemannen und Kelten. Deren Vorzeit hatte es ihm schon seit jeher angetan, und so legte er dort seinen ersten Roman an.“Rusto” heißt er und wartet auf der PC-Festplatte noch immer geduldig auf einen Verleger. Zusammen mit dem Versepos, das Fakler über Gaius Julius Caesar geschrieben hat. “Heldengeschichten haben mich von klein auf fasziniert.”
Doch der Oberschwabe aus Reusten ist nicht nur Schriftsteller. Er malt auch. Freudig zeigt er auf die satten, vielfarbigen Ölgemälde rings an der Wand. Konkrete Landschaftsmotive der Region mischen sich mit Phantastischem, Surrealem. “Malen”, sagt Fakler, „das ist für mich, wie wenn man aus einem Luftballon die Luft rauslässt. “Will sagen: Malend wird er inneren Überdruck los, oder auch seine Kopfschmerzen. Zudem komponiert er gerne, schreibt eine Musik, die alles Laute und lärmige dieser Welt verdrängen und ersetzen will durch Wohlklang. Ihm setzt die Welt vor allem als Geräuschkulisse zu, weshalb er an den meisten Stunden des Tages Ohrstöpsel trägt.
Roland Fakler ist ein ländlicher Privatgelehrter und Lebenskünstler, wie es nicht viele gibt. Man fühlt sich gedrängt, ihn zu fragen: “Und wovon leben Sie?” “Ich lebe bescheiden”, antwortet er, “ohne Auto zum Beispiel. Außerdem gibt es Sponsoren. Wie hat’s van Gogh gemacht? Er hatte einen Bruder, der ihn unterstützte …”
Spätestens mit seinem Ammerbuch-Buch hat er sich freigeschrieben, scheint es. Anderes soll folgen. Ja, vielleicht macht Fakler sich schon bald daran, aus seinen bislang unveröffentlichten Werken zu veröffentlichen. Möglicherweise die Aphorismen, die er seit langem schreibt. Oder die Tagebücher. Und schon bald hat er vor, sich seinem Ammertäler Publikum bei einer Lesung vorzustellen, womöglich im Reustener Bergcafe.
INFO Buchbestellungen
Aus Liebe zur Kunst und zur Geschichte
Aus Liebe zur Kunst und zur Geschichte
Gäubote Freitag, 12. Oktober 2001 LOKALE KULTUR VON ALEKSANDRA JEFTIC
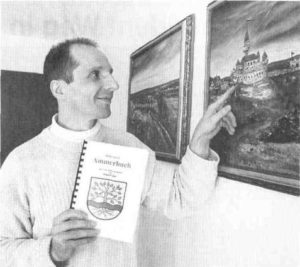 Bücher über Reusten und Ammerbuch
Bücher über Reusten und Ammerbuch
Roland Fakler will Vergangenheit lebendig erhalten.
Zweites Werk herausgegeben.
Roland Fakler: 2001
“Denken war meine erste Leidenschaft” GB-Foto: Bäuerle
Er sieht sich selbst als seltsamen Typ. Roland Fakler ist eben ein Künstler. Seit 25 Jahren lebt er einsam und zurückgezogen in Reusten. Vor einem Jahr begann er für sein Buch “Reusten und seine Geschichte” zu recherchieren. Seit dieser Woche gibt es nun ein zweites Werk, das “Bilderbuch Ammerbuch”. Dabei ist er eigentlich freischaffender Maler.
Etwas ungewöhnlich ist der Lebenslauf des 1953 in Leutkirch geborenen Künstlers schon. Fakler holt weit aus, wenn er erzählt. Mit neun Jahren bat er seine Mutter, ihn in ein Schülerheim zu schicken. Er fühlte sich zu Höherem berufen und konnte den Lärm am heimischen Herd nicht länger ertragen. Doch auch dort fand er nicht die ersehnte Ruhe und betete zu Gott, er möge ihm doch helfen. Als keine Besserung eintrat entschied er sich, einfach nicht mehr an ihn zu glauben. Mit 16 Jahren verließ er das Schülerheim und kam auf’s Gymnasium nach Leutkirch. Nachdem Abitur und der Bundeswehr schrieb er sich an der Uni Tübingen für ein Medizinstudium ein und zog dann nach Ammerbuch.
Schon nach einem Semester merkte er, dass er lieber schreiben wollte. In kürzester Zeit verfasste er einige Romane und Gedichte, die allerdings von über 50 Verlagen abgelehnt wurden. “Denken war meine erste Leidenschaft”, sagt er heute. Dem folgten seine Liebe für Geschichte und für die Kunst. Seit 25 Jahren lebt er als freischaffender Künstler in Reusten ein bescheidenes Leben. “In erster Linie geht es mir um die Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit, um meine Freiheit”, sagt Fakler.
Vor etwas mehr als einem Jahr brachten ihn Nachbarskinder auf die Idee, ein Buch über Reusten zu schreiben. Sie stellten ihm Fragen, die er nicht beantworten konnte: über den Kirchberg, über die Burg und die Römerstraße. Schnell fiel ihm auf, dass nicht nur er diese Fragen nicht beantworten konnte. Es gab auch keine Bücher, die Aufschluss geben konnten. Da beschloss er, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Er sah das als Gelegenheit, seine drei Leidenschaften einzubringen: das Schreiben, sein Interesse für Geschichte und seine Malereien. Durch Zufall stieß er im Bergcafe auf einen Gesprächspartner, der sich in Reusten wie in seiner Westentasche auskennt und willig war, ihm bei seinen Recherchen zu helfen. So kam es, dass Fakler und der 75 Jahre alte Reustener, der “aus Bescheidenheit” nicht genannt werden will (Rudolf Fritz), ein halbes Jahr zusammen saßen und die Reustener Geschichte rekonstruierten. “Wir hätten es ohne einander beide nicht geschafft, dieses Buch zu schreiben”, sagt Fakler. Doch natürlich steckt noch sehr viel mehr Arbeit dahinter: Er wälzte nächtelang Bücher, Chroniken, sprach mit weiteren Reustenern und suchte im Internet nach noch mehr Informationen.
Nach sechs Monaten war “Reusten und seine Geschichte” fertig. Längst hatte er beim Sammeln der Informationen gemerkt, dass es auch über Ammerbuch kein solches Buch gab und beschloss, auch daran zu arbeiten. Nun ist es fertig. Faklers Bücher sind eine geschichtliche Dokumentation, einfach geschrieben mit farbigen, selbst gemalten Bildern, mit Informationen über Landwirtschaft und Kultur. Die Wappen werden erklärt und Ortsnecknamen verraten. “Eigentlich sollte es ja nur eine dünne Broschüre für Kinder werden” räumt er ein. Sein Anliegen ist es, dass die Geschichte der Gemeinde Ammerbuch nicht in Vergessenheit gerät.
“Teil der Reustener Geschichte”
Die Reaktionen auf das erste Buch seien fast durchweg positiv gewesen, sagt Fakler. “Einige haben kritisiert, dass ich das Dritte-Reich-Thema aufwärmen würde und haben gefragt, ob ich das nicht weglassen könnte. Aber diese Menschen verstehen nicht, dass dies ein Teil der Reustener Geschichte ist.” Eine Frau habe in einem Gespräch sogar geweint, da sie die Erinnerungen jahrelang verdrängt hatte. Andere wiederum seien nicht zufrieden mit der Darstellung ihrer Vorfahren oder hätten gerne mehr über sie in dem Buch gelesen. Fakler lässt sich durch solche Reaktionen nicht beirren. Und der Verkauf gibt ihm offenbar recht: Mittlerweile habe er 120 Exemplare des Heimatbuchs verkauft. Nun würde er auch gerne einige seiner Bilder an den Mann bringen, die in den Büchern zu sehen sind. “Die Leute finden die Bilder schön und schauen sie sich gerne an, aber Kaufanfragen hatte ich durch die Bücher leider noch nicht.” Das ist wohl das schwere Los eines Künstlers.

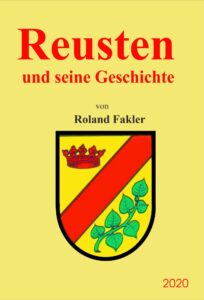
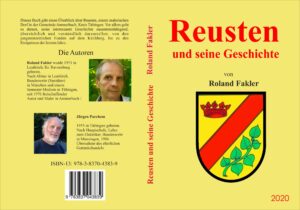

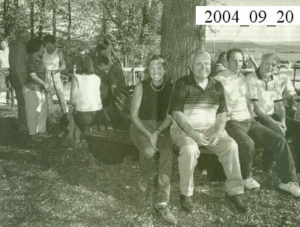 Ein Plätzchen zum Verweilen – das war auch früher so: Bank an der Betteleiche in Reusten GB-Foto: Holom
Ein Plätzchen zum Verweilen – das war auch früher so: Bank an der Betteleiche in Reusten GB-Foto: Holom