Showing posts from category: Allgemein
Weltentstehungsmythen
Weltenstehungsmythen
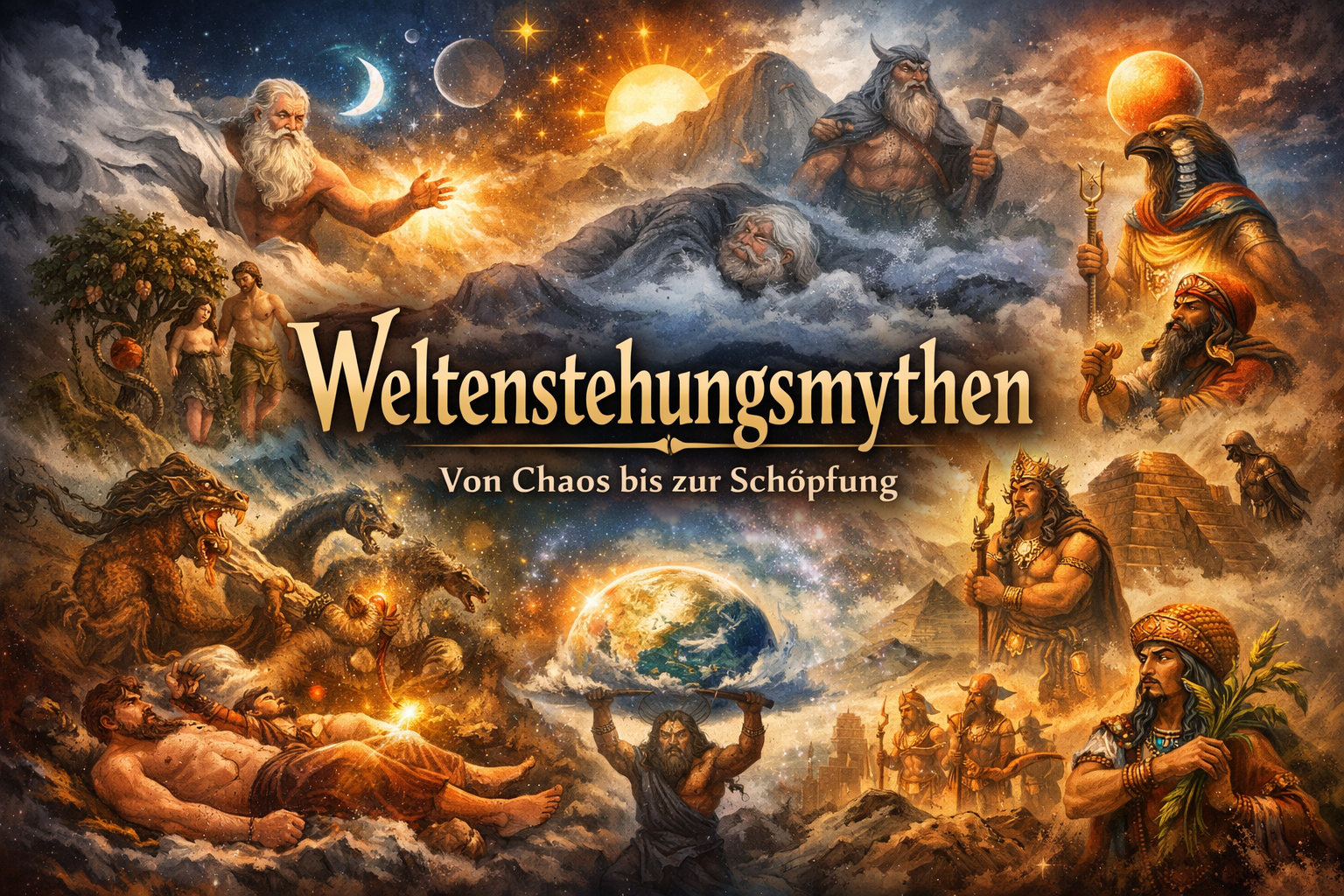
Von Chaos zur Ordnung – Die wichtigsten Schöpfungserzählungen der Menschheit
1. Mesopotamien (ca. 2000–1200 v. Chr.)
Enuma Elisch: Der Gott Marduk besiegt die Urgöttin Tiamat. Aus ihrem Körper entstehen Himmel und Erde. Der Mensch wird geschaffen, um den Göttern zu dienen.
2. Ägypten (ca. 2000 v. Chr. und älter)
Am Anfang existiert das Urwasser (Nun). Daraus erhebt sich der Sonnengott, der weitere Götter erschafft und die Welt ordnet.
3. Indien – Rigveda (ca. 1500–1200 v. Chr.)
Purusha-Hymne: Der kosmische Urmensch wird geopfert. Aus seinen Körperteilen entstehen Welt und Gesellschaft.
4. Hebräische Tradition (ca. 1000–500 v. Chr.)
Genesis: Gott erschafft die Welt in sechs Tagen durch sein Wort. Der Mensch wird als Ebenbild Gottes geschaffen.
5. Griechenland (ca. 700 v. Chr.)
Aus dem Chaos entstehen Gaia und Uranos. Nach mehreren Göttergenerationen übernimmt Zeus die Herrschaft.
6. China (überliefert ab ca. 300 v. Chr.)
Pangu: Aus einem kosmischen Ei entsteht Pangu. Er trennt Himmel und Erde. Sein Körper wird zur Welt.
7. Nordisch-germanische Tradition
Im leeren Raum Ginnungagap entsteht der Urriese Ymir. Die Götter formen aus seinem Körper die Welt.
8. Rom (1. Jh. v. Chr.)
Aus dem Chaos bringt eine göttliche Macht Ordnung in Himmel, Erde und Meer.
9. Maya – Popol Vuh
Die Götter erschaffen mehrfach Menschen. Erst der Mensch aus Mais gelingt dauerhaft.
10. Islam (7. Jh. n. Chr.)
Allah erschafft Himmel und Erde in sechs Zeitabschnitten. Adam wird aus Lehm geformt.
Gemeinsame Motive
- Chaos oder Urwasser am Anfang
- Ordnung durch göttliche Macht
- Schöpfung durch Wort, Kampf oder Opfer
- Besondere Rolle des Menschen
Zentrale Vergleichsmotive
| Kultur | Anfangszustand | Wie entsteht die Welt? | Rolle des Menschen | Besonderes Motiv |
|---|---|---|---|---|
| Judentum / Christentum | Formlose Erde, Finsternis | Gott erschafft durch sein Wort (Bibel) | Ebenbild Gottes | Schöpfung durch Sprache |
| Islam | Himmel und Erde ungeordnet | Allah erschafft in sechs Zeitabschnitten (Koran) | Statthalter Gottes | Göttliche Allmacht |
| Griechisch | Chaos | Generationen von Göttern entstehen (Hesiod) | Spielball der Götter | Götterkämpfe |
| Römisch | Chaos | Göttliche Ordnung bringt Struktur (Ovid) | Teil kosmischer Ordnung | Ordnung aus Formlosigkeit |
| Nordisch | Leerer Raum (Ginnungagap) | Welt aus dem Körper Ymirs (Edda) | Von Göttern erschaffen | Weltschöpfung aus Opfer |
| Ägyptisch | Urwasser (Nun) | Sonnengott entsteht und schafft Götter | Diener der Götter | Schöpfung aus Wasser |
| Mesopotamisch | Urchaos aus Wasserwesen | Marduk besiegt Tiamat | Zum Dienst geschaffen | Kosmischer Kampf |
| Indisch | Kosmischer Urmensch | Welt aus Opfer des Purusha | Teil kosmischer Ordnung | Opfer als Ursprung |
| Chinesisch | Kosmisches Ei | Pangu trennt Himmel & Erde | Später erschaffen | Körper wird Welt |
| Maya | Leere, stille Welt | Mehrere Schöpfungsversuche (Popol Vuh) | Aus Mais geschaffen | Mensch aus Naturstoff |
Lebensgebet
Lebensgebet
Dieses Gedicht von Lou Salome hat mich schon in meiner Jugend fasziniert,
jetzt im Alter noch viel mehr.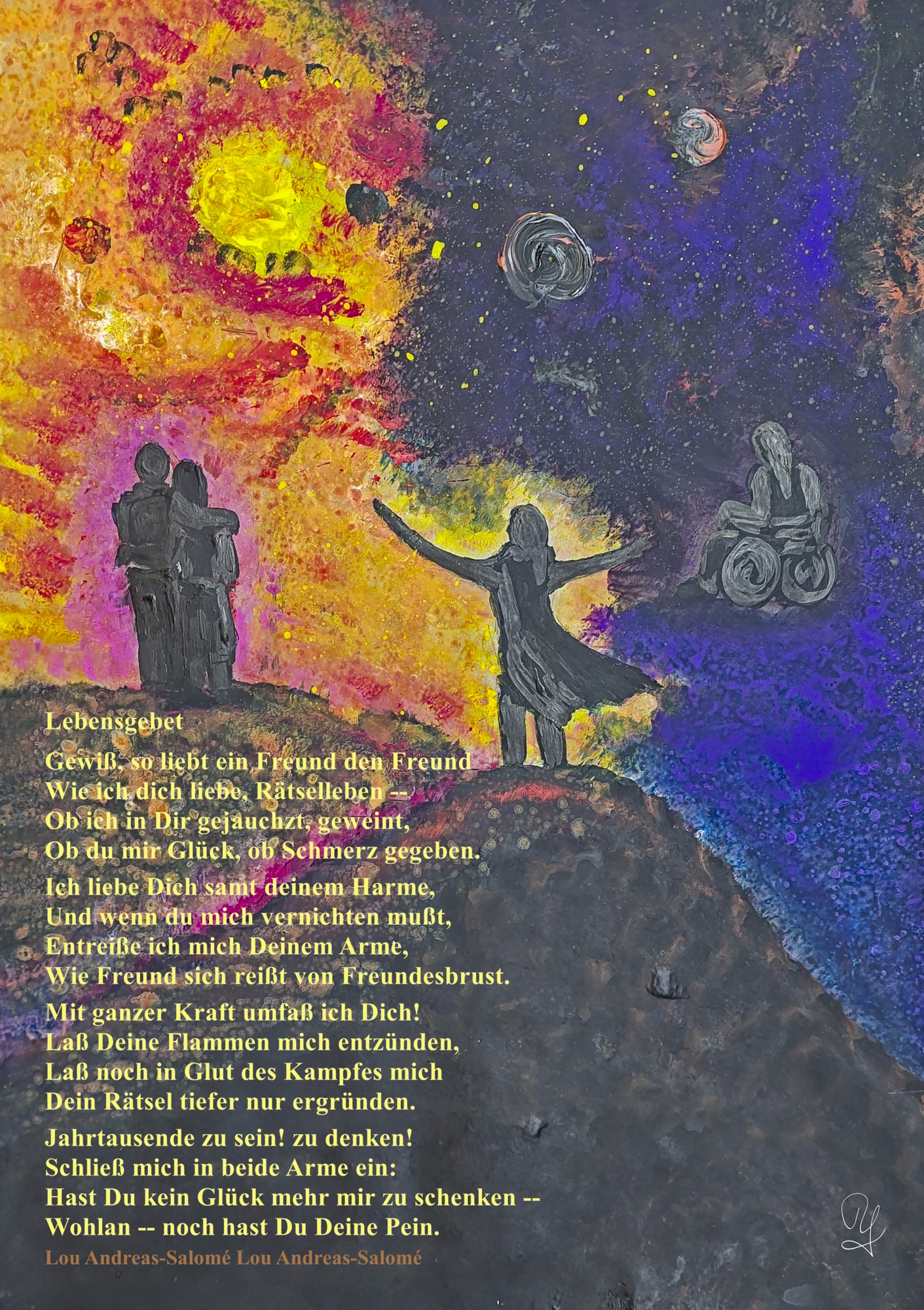
Abtreibung
Demokratie bewährt
Demokratie schlägt Autokratie
Audio
Was spricht dafür, dass wir unsere bewährten westlichen Werte verteidigen sollten?
Der ehemalige Chefmoderator des „heute journal“ Claus Kleber berichtete in Tübingen von seinen Erfahrungen in Amerika, Europa und Asien.
Es gibt nicht die eine ideale Regierungsform, aber es gibt eindeutig bessere und schlechtere. Dass Deutschland unter der Demokratie seine längste Friedensperiode, sowie relativen Wohlstand in Freiheit erlebt hat, ist kein Zufall, sondern ihr Verdienst. Wer sehnt sich heute ernsthaft zurück in die Stasi-Gefängnisse der DDR, unter die Terrorherrschaft des Faschismus oder in jene Zeiten, in denen die Könige von Gottes Gnaden und die katholische Kirche das Volk in Armut, Abhängigkeit und Unmündigkeit hielten?
Demokratie ist anfällig für Manipulation, Medienmacht und Volksverführung – und sie kann deswegen zu falschen Mehrheitsentscheidungen führen. Doch sie garantiert, was Autokratien grundsätzlich verweigern: Meinungs- und Medienfreiheit sowie den Schutz der Menschenrechte. Diese geraten in China, Russland, Iran und zunehmend auch in den USA unter den Druck willkürlich herrschender Machthaber.
Demokratie bedeutet Rechtsstaatlichkeit, Machtbegrenzung, Machtkontrolle, sowie Mitsprache und Teilhabe der Bürger. Autokratie hingegen heißt Willkürherrschaft, Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft und das Festklammern von Eliten und Familienclans an der Macht…bis zur Schmerzgrenze des Volkes. Siehe: Iran!
Demokratie ist die Regierungsform, die am ehesten geeignet ist, das Leid auf der ganzen Welt zu mindern und Willkürherrschaft zu verhindern. Das Ziel müsste es sein, eine gerechte und lebenswürdige Welt zu schaffen, die auf Nachhaltigkeit gründet, nicht auf immer mehr Verbrauch und Zerstörung.
Geschichtlichkeit Jesu
War Jesus eine geschichtliche Persönlichkeit?
Audio
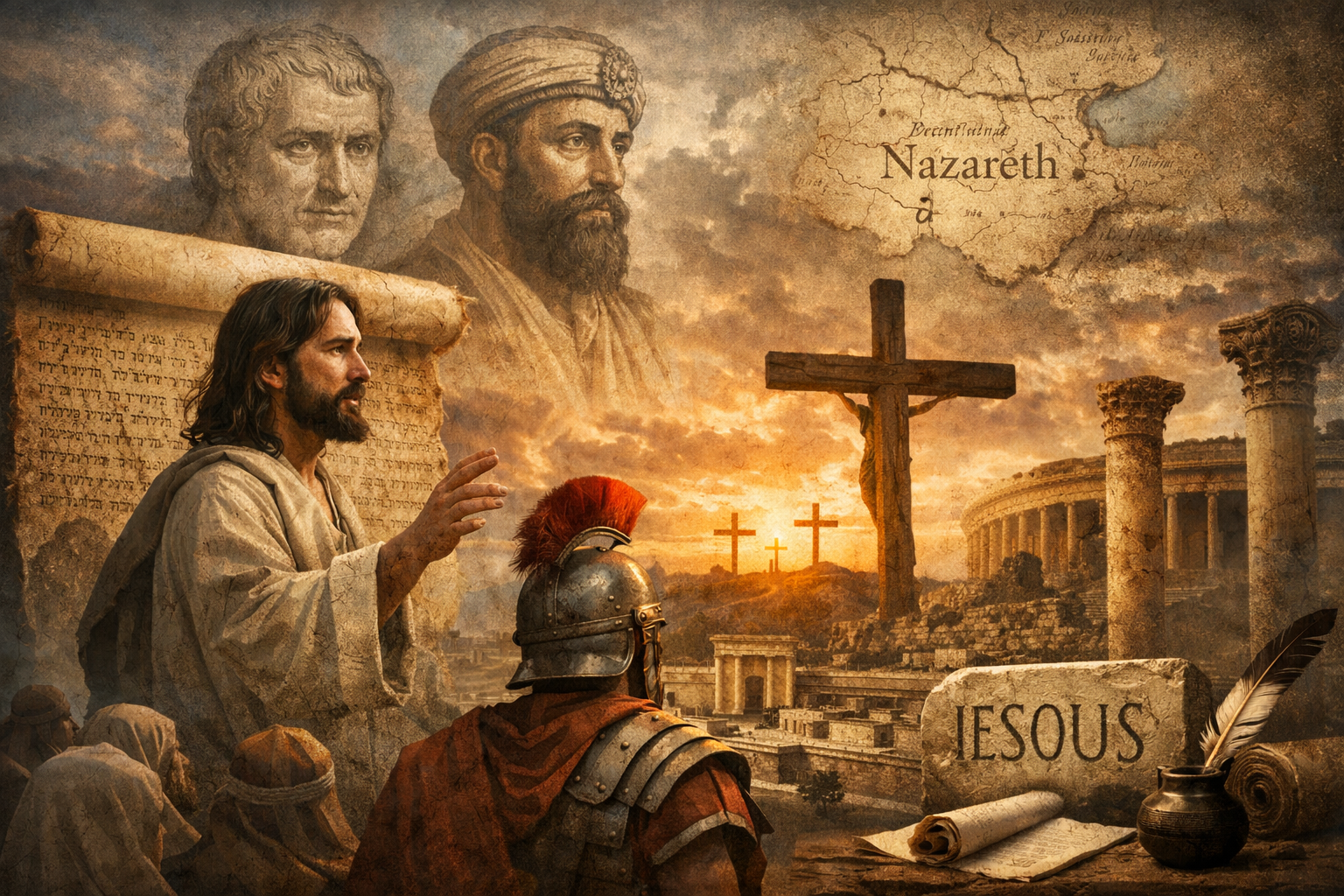
Für mich ist die Frage nach der historischen Existenz Jesu keine Glaubensfrage mehr, sondern eine historische. Jesus spielt in meinem Leben keine religiöse Rolle; gerade deshalb kann ich mich ihm vergleichsweise unvoreingenommen nähern. Die glaubwürdigste Quelle für Persönlichkeitsentwicklung ist für mich die eigene Erfahrung – und aus dieser Perspektive erkenne ich erstaunliche Parallelen zwischen meiner eigenen Entwicklung und der Gestalt des galiläischen Wanderpredigers.
Warum ist das Christentum entstanden? Diese Frage ist nicht einzigartig. Man könnte ebenso fragen, warum der Zoroastrismus, der Buddhismus oder der Islam entstanden sind. Meine Antwort lautet: weil eine charismatische Persönlichkeit auf eine Zeit traf, die reif für eine neue Deutung der Welt war. Große historische Gestalten erkennen ihre Aufgabe in den Möglichkeiten ihrer Epoche und geben ihr einen entscheidenden Impuls. Geschichte entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern im Zusammenspiel von Persönlichkeit und Zeitgeist.
Eine der stärksten Triebfedern historischer Prozesse ist der Wille zur Macht. Das Christentum wurde maßgeblich von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten geprägt: Jesus, Paulus und Konstantin. Schon diese drei stehen für drei grundverschiedene „Christentümer“. Jesus enttäuschte die messianischen Erwartungen seiner Zeit. Erwartet wurde ein militärischer Befreier, kein pazifistischer Prediger. Dass Jesus diese Rolle nicht erfüllte, spricht eher für seine Historizität: Eine erfundene Figur hätte man problemlos an die Erwartungen angepasst. Eine reale Persönlichkeit aber folgt ihrer eigenen inneren Logik.
Paulus brachte eine völlig andere Prägung ein: dogmatisch, sexualfeindlich, frauenfeindlich, staatshörig und missionarisch aggressiv. Konstantin schließlich machte aus dem religiösen Gemenge ein Herrschaftsinstrument – zur Legitimation der Macht, zur Einigung des Reiches und zur Vertröstung der Massen auf ein Jenseits. Ein solches Wirrwarr planvoll zu konstruieren ist jedoch weit schwieriger, als es organisch entstehen zu lassen. Die innere Widersprüchlichkeit des Christentums spricht eher für gewachsenes Chaos als für eine bewusste Erfindung.
Die Evangelien sind keine neutrale Geschichtsschreibung. Sie verfolgen ein klares Ziel: Jesus als den im Alten Testament angekündigten Messias darzustellen. Ihre Autoren schreiben aus dem Glauben heraus und passen die Überlieferung, wo nötig, an die Weissagungen an. Ortsangaben, Namen und Geburtsgeschichten tragen oft literarische Züge. Doch Dichtung schließt Historizität nicht aus. Dass Jesus „von Nazareth“ genannt wird, obwohl der Messias aus Bethlehem stammen sollte, deutet eher darauf hin, dass er tatsächlich aus Nazareth kam und diese Tatsache theologisch überbrückt werden musste.
Ein entscheidender Motor für den Erfolg des Christentums war die soziale Not der damaligen Zeit. Arme, Kranke, Sklaven und Entrechtete fanden Trost in der Hoffnung auf ein Jenseits, in dem die bestehenden Machtverhältnisse umgekehrt würden. Nicht die Reichen und Mächtigen, sondern die Schwachen sollten dort die Ersten sein. Dieses Versprechen war – und ist – wirkmächtig. Das Christentum ist bis heute ein Trostangebot für all jene, denen das Diesseits wenig Hoffnung lässt.
Die Römerfreundlichkeit der Evangelien bei gleichzeitiger Judenfeindschaft erklärt sich historisch. Sie entstanden nach dem Jahr 70, als klar war, dass das Judentum Jesus nicht als Messias akzeptieren würde. Abgrenzung nach innen ging mit Anpassung nach außen einher. Dass das Christentum dennoch von den Römern verfolgt wurde, spricht gegen die These einer römischen Erfindung. Der Verzicht auf den Kaiserkult und der pazifistische Grundzug der Lehre bedrohten Einheit und Wehrhaftigkeit des Reiches. Edward Gibbon sah im Christentum sogar einen Faktor für den Untergang Roms.
Die Werte des Christentums stehen im scharfen Gegensatz zur römischen Elitekultur: Jenseitigkeit gegen Diesseitigkeit, Demut gegen Ruhm, Sklavenmoral gegen Herrenmoral. Warum sollte die römische Oberschicht eine Religion erfinden, die ihre eigenen Grundlagen untergräbt?
Entscheidend für meine Einschätzung ist jedoch die innere Logik der dargestellten Persönlichkeit. Aus den Evangelien spricht kein übermenschlicher Weiser, sondern eine tragische, widersprüchliche Figur: ein junger Mann mit Größenanspruch, hungernd nach Anerkennung, unfähig zu gleichberechtigten Beziehungen, intolerant gegenüber Ablehnung, konflikthaft gegenüber Familie und Umwelt. Seine Brüder hielten ihn für verrückt. Die Menge schrie: „Wir haben keinen König außer dem Kaiser.“ Er verfluchte Städte, die seine Botschaft ablehnten, und Feigenbäume, die keine Früchte trugen.
Er forderte absolute Hingabe, sprach von Herrschaft, drohte und verfluchte. Er hatte Angst, betete am Ölberg und schwitzte Blut. Das sind keine Züge einer idealisierten Kunstfigur, sondern typische Merkmale eines bestimmten Entwicklungsstadiums starker Persönlichkeiten. Sie sind sehr von sich überzeugt und lösen damit ein Tauziehen aus, die anderen versuchen, sie so klein wie möglich zu machen.
Solche Figuren kennt die Geschichte: Giordano Bruno, Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Van Gogh. Zu Lebzeiten verkannt, nach dem Tod verklärt. Starke Menschen lösen ein Tauziehen aus: Entweder sie setzen sich durch und werden zu Tyrannen – oder sie werden gebrochen. Jesus gehört zur zweiten Kategorie. Seine Kreuzigung zwischen Verbrechern, die demonstrative Demütigung, die Freilassung eines Schuldigen – all das passt in dieses Muster.
Die abrupten Umschwünge – vom jubelnden Einzug in Jerusalem zur völligen Ablehnung – sprechen ebenfalls für Historizität. Mythen sind glatt, reale Biographien nicht.
Was wissen wir also über den historischen Jesus? Es gibt keine zeitgenössischen Berichte, keine Biographie, keine eigenen Schriften. Die Evangelien sind Glaubenszeugnisse, keine neutralen Quellen. Paulus, unsere früheste schriftliche Quelle, interessiert sich kaum für das Leben Jesu, setzt seine Existenz jedoch voraus und kennt seinen Bruder Jakobus. Josephus und Tacitus erwähnen seine Hinrichtung beiläufig. Der historische Kern ist schmal, aber stabil: Jesus war ein jüdischer Wanderprediger, verkündete das Reich Gottes, sammelte Anhänger, geriet in Konflikt mit den Autoritäten und wurde gekreuzigt.
Der historische Jesus ist nicht der Christus der Kirchen. Diese Gestalt entstand erst nach seinem Tod. Wir wissen genug, um vermuten zu können, dass Jesus existierte – und zu wenig, um ihn eindeutig zu verstehen. Vielleicht liegt gerade darin seine Wirkungsmacht: Eine reale, unvollkommene, tragische Figur, die nach ihrem Tod zur Projektionsfläche für Macht, Hoffnung, Angst und Erlösung wurde.
Die Geschichte kennt viele Sieger. Jesus war keiner. Und doch hat kaum jemand die Geschichte so nachhaltig geprägt.
Jesu Größenwahn
Jesu Größenwahn

Psychologische, theologische und historische Betrachtungen
Größenwahn bei jungen Männern ist kein ungewöhnliches Phänomen. Viele machen diese Phase durch, auch ich selbst. Problematisch wird es jedoch dann, wenn solche Selbstüberhöhungen nicht relativiert, sondern religiös überhöht und sakralisiert werden. Im Fall Jesu von Nazareth scheint genau dies geschehen zu sein – mit historisch verheerenden Folgen.
Nimmt man den Größenwahn eines Einzelnen so ernst, wie er selbst es fordert, entstehen Ideologien, die Intoleranz, Ausschließlichkeit und Gewalt legitimieren. Die Geschichte des Christentums liefert dafür zahlreiche Belege: endlose Streitigkeiten über die Person Jesu, Religionskriege, Ketzerverfolgungen und ein jahrhundertelanger christlicher Antijudaismus, der letztlich im Holocaust mündete.
Was hat der „Retter“ bewirkt?
Was also hat der angebliche „Retter der Welt“ tatsächlich gebracht?
Frieden, Versöhnung, menschliche Reife?
Oder vielmehr Spaltung, Absolutheitsansprüche und ein rigides Freund-Feind-Denken?
Bereits die neutestamentlichen Texte zeigen, dass Jesus sich selbst in einer einzigartigen, übermenschlichen Rolle sah.
Jesu Selbstansprüche laut Evangelien
In den Evangelien beansprucht Jesus wiederholt göttliche oder gottgleiche Autorität:
Er lässt sich als Sohn Gottes bezeichnen (Mt 26,63), bejaht den Titel König der Juden (Mk 15,2) und erklärt sich selbst zum einzigen Heilsweg:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14,6).
Er verkündet Heil für die Gläubigen und Verdammnis für die Ungläubigen (Mk 16,16), beansprucht Autorität über Leben und Tod (Joh 11,25) und erklärt sich für präexistent:
„Ehe Abraham ward, bin ich“ (Joh 8,58).
Nach seiner Auferstehung betont Jesus seine universale Macht:
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“ (Mt 28,18).
Zugleich fordert er die gleiche Ehre wie Gott selbst und tritt als Weltenrichter auf (Joh 5,22–23).
Abhängigkeit, Ausschluss und Gewaltlogik
Jesus betont immer wieder die totale Abhängigkeit seiner Anhänger von seiner Person:
„Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5).
Wer nicht in ihm bleibt, wird „ins Feuer geworfen“ (Joh 15,6).
Damit entsteht ein klares Freund-Feind-Schema: Glaube bedeutet Rettung, Nichtglaube bedeutet Ausschluss, Vernichtung oder Verdammnis.
Besonders drastisch ist die Aussage:
„Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir“ (Lk 19,27).
Hier zeigt sich ein autoritärer Herrschaftsanspruch, der mit moderner Ethik unvereinbar ist.
Vom persönlichen Anspruch zur kirchlichen Macht
Die frühe Kirche radikalisiert diese Aussagen weiter:
„In keinem andern ist das Heil“ (Apg 4,12).
Aus persönlicher Selbstüberhöhung wird institutionalisierte Heilsmonopolpolitik. Kritik wird Ketzerei, Zweifel Schuld, Nichtglaube ein moralisches Verbrechen.
Fazit
Jesus erscheint in den Evangelien nicht als bescheidener Weisheitslehrer, sondern als Figur mit extremen Selbstüberhöhungen: Sohn Gottes, Weltenrichter, einziger Heilsweg, Herr über Leben und Tod.
Nimmt man diese Aussagen ernst – und genau dazu zwingt das Christentum –, dann trägt nicht nur die Kirche Verantwortung für Intoleranz und Gewalt. Bereits die Ursprungstexte selbst legen diese Entwicklung nahe.
Der religiös legitimierte Größenwahn eines Einzelnen wurde zur Grundlage einer Weltreligion – mit Folgen, die Millionen Menschen das Leben gekostet haben.
Ergänzende Zitate
Jesus hält sich für den Mat:26:63 Sohn Gottes und den Mark:15:2 König der Juden Er behauptet: Joh. 14:6 „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Mk. 16:16 „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden“. Mat. 23:8 Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder. Joh. 8:51. „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: So jemand mein Wort halten wird, der wird den Tod nicht sehen ewiglich“; und Joh. 8:58 „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ehe denn Abraham ward, bin ich.“ Math 26:61 „Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen.“ Joh. 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus betont die Abhängigkeit der Jünger von ihm für ihre geistliche Fruchtbarkeit. Joh 11:25 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; Luk. 19:27 „Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir.“ Er vernichtet seine Gegner und Kritiker Joh. 15:6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorret, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wer nicht sein Anhänger sein will wird ins Feuer geworfen. Apostelgeschichte: 4:12 12 Und ist in keinem andern-Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. (als Jesus) Absolutheitsanspruch der Kirche. Matthäus 16:15-17 – „Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! – Jesus bestätigt hier die Erkenntnis von Petrus und bekräftigt seine Identität als der Sohn Gottes. Johannes 5:22-23 – „Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.“ – Jesus betont seine Rolle als Richter und fordert die gleiche Ehre, die dem Vater zusteht. Johannes 10:17-18- „Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich’s wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.“ Jesus spricht über seine Autorität über Leben und Tod. Matthäus 28:18- „Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“- Nach seiner Auferstehung betont Jesus seine umfassende Macht und Autorität. Lukas 4:18-21“Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen; Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren.“- Jesus erklärt, dass die prophetische Schriftstelle aus Jesaja in ihm erfüllt ist. Johannes 14:9 – Jesus erklärt, dass das Sehen ihn gleichbedeutend mit dem Sehen des Vaters ist. z. B. Matthäus 28,18) > „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“
→ Spätestens hier wird deutlich: Jesus sieht sich als universaler Herrscher.
Jesus beanspruchte Herrschaft.
Er verstand sich als König eines anderen Reiches, als göttlicher Gesandter, aber zugleich als derjenige, dem am Ende alle Macht zusteht.
Pahlavi
Wie Königsdynastien enstehen
Wie Königsdynastien entstanden, am Beispiel der Pahlavis, die sich dann den Titel “König der Könige” gaben und 1971 das 2500- jährige Thronjubiläum feierten, das 300 Millionen Euro kostete. Der Großvater des heute in den USA lebenden Sohnes des geflohenen Schahs – also Reza Schah Pahlavi (Reza Shah Kabir) – war nicht von adliger Abstammung. Seine Herkunft war bescheiden und militärisch geprägt: · Einfache Herkunft: Er wurde 1878 in eine Familie mittleren bis einfachen Standes in der Provinz Masandaran geboren. Sein Vater und Großvater waren Militäroffiziere, aber keine Adeligen. · Militärkarriere: Reza Schah trat als einfacher Soldat in die persische Kosakenbrigade ein und stieg durch außergewöhnliche Fähigkeit und Charisma bis zum Kommandeur auf. · Selbstgemachter Mann und Dynastiegründer: Durch einen Putsch ergriff er 1921 die Macht und ließ sich 1925 zum Schah krönen. Er begründete die Pahlavi-Dynastie, d.h., er schuf den neuen “Adel” bzw. die Herrscherfamilie erst selbst. Zusammenfassung: Reza Schah war ein “self-made man” und kein gebürtiger Adeliger. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und errang den Thron durch militärischen und politischen Aufstieg. Seine Nachkommen (sein Sohn Mohammad Reza Schah und sein Enkel Reza Pahlavi) sind dann natürlich durch ihn als Dynastiegründer zu königlichem Blut geworden. Fast jede Dynastie begann mit einem Emporkömmling, der dann für seine Nachkommen königliche Rechte gemäß königlicher Geburt einforderte. …und die Leute glaubten den Unsinn.
Siehe: rolandfakler.de/koenigsdynastien
Königsdynastien
Equality
The Idea of Equality: A European Intellectual History
Audio

by Roland Fakler
The idea that human beings ought to possess equal rights despite their factual inequality is one of the most significant achievements of European political thought. This principle is neither self-evident nor timeless; rather, it is the result of a long and often contradictory intellectual development marked by gradual advances, setbacks, and tensions.
Early reflections on human equality can already be found in ancient Greek philosophy. The Sophists, particularly figures such as Antiphon, challenged conventional distinctions between Greeks and non-Greeks and argued that all humans are equal by nature. In his fragment On Truth, Antiphon famously maintained that natural needs and capacities are shared by all humans, while social differences are merely conventional (Antiphon, Peri Alētheias, frag. B44 DK). This conception of equality was anthropological rather than political, but it represented an important departure from ethnocentric hierarchies.
Stoic philosophy further developed this universalist outlook. Thinkers such as Zeno of Citium, Seneca, and later Marcus Aurelius argued that all human beings participate in the logos, the universal rational principle governing the cosmos. From this followed the idea of a moral equality of all persons and the notion of a cosmopolitan human community (see Cicero, De Legibus I; Marcus Aurelius, Meditations VI.44). However, Stoic equality remained fundamentally ethical and internal; it did not translate into a rejection of political hierarchies or institutions such as slavery.
A remarkable exception within ancient philosophy is Epicurus. In his Garden, women, slaves, and free men were admitted on equal terms, an inclusion highly unusual for the time (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, X). Although Epicureanism did not advocate political equality, it embodied a practical recognition of human equal worth within a philosophical community, anticipating later egalitarian intuitions.
Roman philosophy inherited much of the Stoic framework. Seneca, for example, explicitly acknowledged the humanity and moral dignity of slaves (Epistulae Morales, 47). Yet he did not question the legitimacy of slavery as an institution. Here again, moral equality did not entail equal legal or political rights.
Christianity introduced a new dimension to the concept of equality by proclaiming the spiritual equality of all human beings before God. Passages such as Galatians 3:28 (“There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female”) express this theological universalism. However, this spiritual equality excludes non-believers; it coexisted with social conservatism. In several Pauline letters, existing hierarchies are affirmed: women are urged to submit, and slaves are instructed to obey their masters (e.g., 1 Corinthians 14:34–35; Ephesians 6:5). As a result, early Christianity tended to reinforce rather than dismantle social inequality.
Medieval scholasticism preserved this ambivalence. Thomas Aquinas grounded human dignity in the shared rational nature of all persons (Summa Theologiae, I–II, q.94), yet he defended hierarchical social structures, legitimised coercion against heretics, and accepted religious intolerance as compatible with the common good (Summa Theologiae, II–II, q.11). Equality remained metaphysical, not juridical.
The Reformation did not produce a decisive breakthrough either. Martin Luther’s doctrine of obedience to worldly authority (Von weltlicher Obrigkeit) and his virulent anti-Jewish writings (Von den Juden und ihren Lügen) stand in clear tension with modern notions of equality. Similarly, John Calvin’s theocratic governance in Geneva tolerated little religious dissent. Religious reform thus coincided with new forms of exclusion and confessional rigidity.
A genuine turning point emerges only with the Enlightenment. Early modern political philosophers articulated a secular foundation for equal rights. Thomas Hobbes derived equality from the shared vulnerability of human beings in the state of nature (Leviathan, ch. 13). John Locke grounded equality in natural rights possessed by all individuals (Second Treatise of Government, §§4–6). Jean-Jacques Rousseau located equality in political self-legislation through the social contract (Du contrat social, I.6). Voltaire championed religious tolerance (Traité sur la tolérance), while David Hume advanced a form of moral universalism grounded in shared human sentiments (An Enquiry Concerning the Principles of Morals).
Here, for the first time, the idea of equal rights independent of talent, status, religion, or gender takes systematic form. Enlightenment thinkers recognised a crucial distinction: human beings are not equal in their abilities, virtues, or achievements, but they must be equal before the law. This legal equality becomes the foundation of social peace, political legitimacy, and individual freedom.
From this perspective, criticism of ideologies that institutionalise legal inequality is both legitimate and necessary. Such criticism need not be directed at individuals, but at normative systems. It is therefore possible to respect Muslims as persons while critically examining elements of classical Islamic doctrine that assign unequal legal status to women or non-Muslims (e.g., dhimmi regulations in classical fiqh; see quran). The same critical standard applies to any religious or secular doctrine.
Equal rights are not a natural given; they are a fragile intellectual and political achievement of the Enlightenment. Their preservation requires continuous philosophical reflection and moral vigilance.
Selected Sources (Primary and Secondary)
Ancient and Medieval
-
Antiphon, Fragments, in Diels/Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker
-
Aristotle, Politics
-
Cicero, De Legibus
-
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers
-
Seneca, Epistulae Morales
-
Thomas Aquinas, Summa Theologiae
Early Modern / Enlightenment
-
Hobbes, Thomas: Leviathan (1651)
-
Locke, John: Second Treatise of Government (1689)
-
Rousseau, Jean-Jacques: Du contrat social (1762)
-
Voltaire: Traité sur la tolérance (1763)
-
Hume, David: An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751)
Modern Secondary Literature
-
Isaiah Berlin: Two Concepts of Liberty
-
Larry Siedentop: Inventing the Individual (2014)
-
Bernard Williams: Ethics and the Limits of Philosophy
-
Bernard Lewis: The Jews of Islam (1984)
-
Abdullahi Ahmed An-Na‘im: Islam and the Secular State (2008)
Gleichheit
Woher kommt die Idee der Gleichwertigkeit aller Menschen
Audio
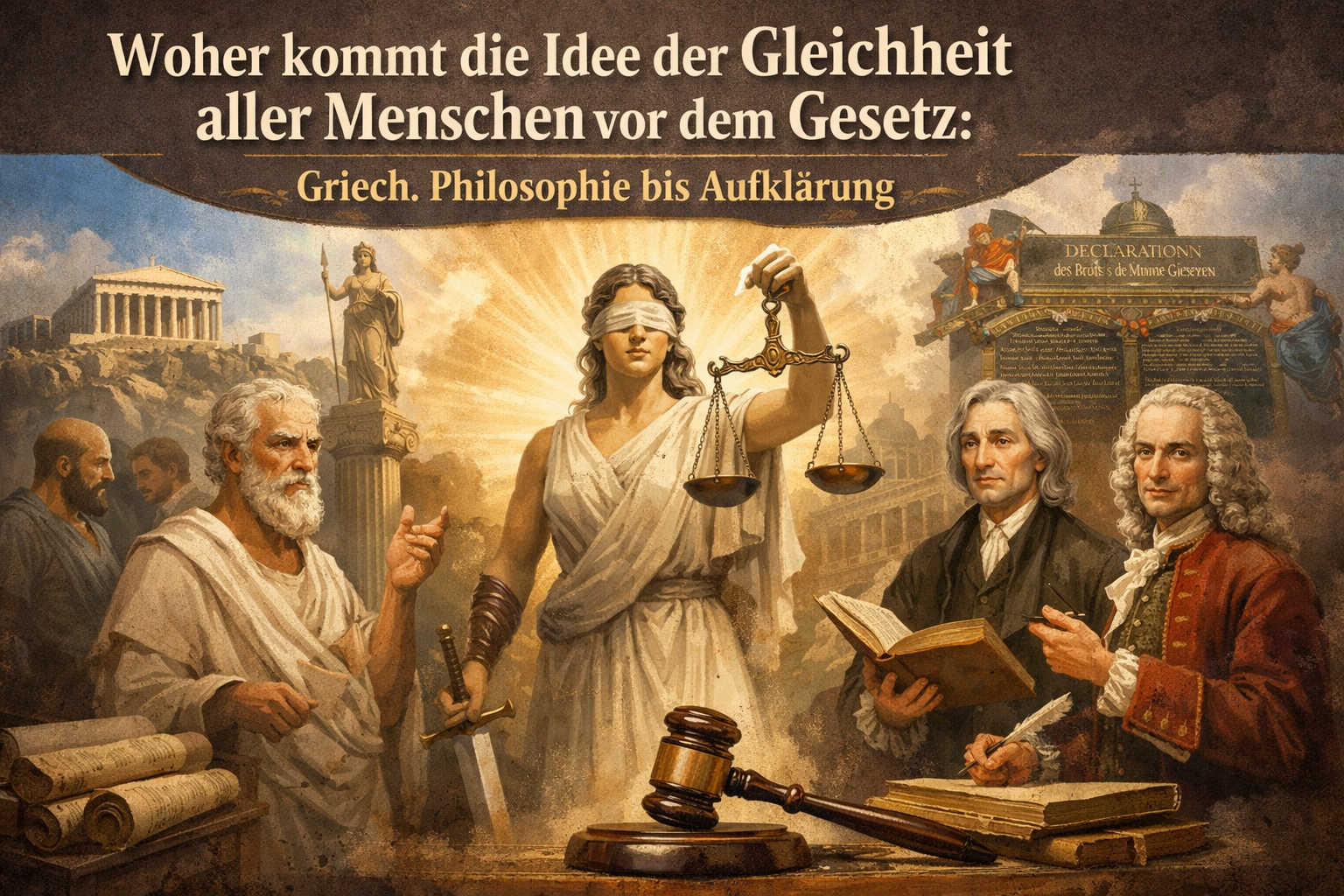 Sophisten (5.–4. Jh. v. Chr.)
Sophisten (5.–4. Jh. v. Chr.)
Die Sophisten waren unter den ersten griechischen Denkern, die über die Gleichheit aller Menschen reflektierten. Sie unterschieden zwischen phýsis (Natur) und nómos (Gesetz oder Konvention) und kritisierten gesellschaftliche Hierarchien als künstlich und willkürlich.
-
Alkidamas (Schüler des Gorgias): „Die Natur hat niemanden zum Sklaven gemacht.“ → Eine klare Zurückweisung der Vorstellung, Sklaverei sei naturgegeben.
-
Lykophron: → Sah das Gesetz als eine Art Vertrag zwischen Menschen, bei dem Abstammung oder Herkunft keine Rolle spielen.
🔹 Die Sophisten legten damit einen frühen Grundstein für die Idee der menschlichen Gleichwertigkeit, indem sie Natur und gesellschaftliche Konvention auseinanderhielten.
Stoiker (3. Jh. v. u. Z. – Kaiserzeit)
Die Stoa gilt als die bedeutendste antike Schule für die Vorstellung von universaler Gleichheit und menschlicher Brüderlichkeit.
-
Zenon von Kition (Begründer der Stoa): → Entwarf die Vision einer kosmopolitischen Gemeinschaft ohne Herrschaft und Sklaverei. → Der Mensch ist „Kosmopolitēs“ – ein Bürger der Welt.
-
Kleanthes und Chrysippos: → Lehrten, dass alle Menschen an der Vernunft (lógos) teilhaben und somit Glieder einer gemeinsamen kosmischen Gemeinschaft sind.
- Epikur 341- 270 In seinem Garten lernten Sklaven, Frauen und Freie gemeinsam. Er lehnte Hierarchien ab. Freundschaft statt politischer Rang. Jeder ist fähig zum Glück, alle sind sterblich.
-
Seneca: „Wir sind alle gleich durch die Geburt, alle Sklaven desselben Todes.“ → Betonung der geistigen Gleichheit und Aufforderung zu milder Behandlung von Sklaven.
-
Epiktet: → Ehemaliger Sklave. Lehrte, dass wahre Freiheit eine innere, geistige Haltung ist. → Alle Menschen sind „Mitbürger im Kosmos“ und Teil derselben menschlichen Gemeinschaft.
🔹 Die stoische Ethik hatte erheblichen Einfluss auf spätere Konzepte der Menschenwürde und universalen Brüderlichkeit, insbesondere im Christentum.
Kyniker
- Diogenes von Sinope: → Bezeichnete sich selbst als Kosmopolit („Weltbürger“). → Verwarf gesellschaftliche Konventionen und Hierarchien zugunsten einer Rückkehr zur Natur. → Zwar keine ausdrückliche „Gleichheitspolitik“, jedoch eine radikale Ablehnung sozialer Rangordnungen.
✨ Zusammenfassung
Philosophische Strömungen mit Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit:
| Schule / Bewegung | Zentrale Ideen |
|---|---|
| Sophisten (Antiphon, Alkidamas) | Naturrecht, Kritik an Sklaverei, Hinterfragung sozialer Hierarchien |
| Stoiker (Zenon, Seneca, Epiktet) | Kosmopolitische Brüderlichkeit, Vernunftgemeinschaft aller Menschen |
| Kyniker (Diogenes) | Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen und Rangunterschiede |
| Epikur | Alle Menschen sind gleichwertig |
| Frühes Christentum (Paulus) | Geistige Gleichheit in Christus, universaler Anspruch – allerdings nur für Gläubige, nicht für Frauen, nicht für Sklaven, nicht für Ungläubige. |
Frühes Christentum
Audio
-
Paulus von Tarsus (1. Jh. n. Chr.): „Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28)
-
Die frühen christlichen Gemeinden verkündeten eine geistige Gleichheit aller Gläubigen, die ethnische, soziale und geschlechtliche Unterschiede überwand.
🔹 Allerdings war diese Gleichheit auf die Gemeinschaft der Gläubigen beschränkt – „Ungläubige“ blieben ausgeschlossen. Frauen galten bei Paulus als minderwertiger. Er rechtfertigt, wie Augustinus, auch die Sklaverei als von Gott gewollt.
In mehreren paulinischen Briefen werden bestehende Hierarchien ausdrücklich bekräftigt: Frauen werden zur Unterordnung aufgefordert, und Sklaven sollen ihren Herren gehorchen (z. B. 1. Korinther 14,34–35; Epheser 6,5). Infolgedessen tendierte das frühe Christentum eher dazu, soziale Ungleichheit zu festigen, als sie aufzulösen.
Die mittelalterliche Scholastik bewahrte diese Ambivalenz. Thomas von Aquin begründete die menschliche Würde in der gemeinsamen rationalen Natur aller Personen (Summa Theologiae, I–II, q.94), verteidigte zugleich hierarchische Gesellschaftsstrukturen, legitimierte Zwang gegenüber Ketzern und hielt religiöse Intoleranz für mit dem Gemeinwohl vereinbar (Summa Theologiae, II–II, q.11). Gleichheit blieb metaphysisch, nicht rechtlich.
Auch die Reformation brachte keinen entscheidenden Durchbruch. Martin Luthers Lehre vom Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit (Von weltlicher Obrigkeit) sowie seine vehementen judenfeindlichen Schriften (Von den Juden und ihren Lügen) stehen in deutlichem Spannungsverhältnis zu modernen Gleichheitsvorstellungen. Ebenso duldete die theokratische Herrschaft Johannes Calvins in Genf kaum religiöse Abweichung. Religiöse Reform ging somit mit neuen Formen der Ausgrenzung und konfessionellen Verhärtung einher.
Ein wirklicher Wendepunkt zeigt sich erst mit der Aufklärung. Frühneuzeitliche politische Philosophen formulierten erstmals eine säkulare Begründung gleicher Rechte.
Thomas Hobbes leitete Gleichheit aus der gemeinsamen Verwundbarkeit der Menschen im Naturzustand ab (Leviathan, Kap. 13).
John Locke begründete Gleichheit in den natürlichen Rechten, die allen Individuen zukommen (Zweite Abhandlung über die Regierung, §§ 4–6).
Jean-Jacques Rousseau verortete Gleichheit in der politischen Selbstgesetzgebung durch den Gesellschaftsvertrag (Du contrat social, I.6).
Voltaire trat für religiöse Toleranz ein (Traité sur la tolérance), während
David Hume eine Form des moralischen Universalismus entwickelte, die auf gemeinsamen menschlichen Empfindungen beruht (Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral).
Hier nimmt erstmals die Idee gleicher Rechte unabhängig von Begabung, sozialem Status, Religion oder Geschlecht eine systematische Gestalt an. Den Denkern der Aufklärung wurde eine zentrale Unterscheidung bewusst: Menschen sind nicht gleich in ihren Fähigkeiten, Tugenden oder Leistungen, wohl aber müssen sie vor dem Gesetz gleich sein.
Diese rechtliche Gleichheit bildet das Fundament von sozialem Frieden, politischer Legitimität und individueller Freiheit.
Aus dieser Perspektive ist die Kritik an Ideologien, die rechtliche Ungleichheit institutionalisieren, sowohl legitim als auch notwendig. Eine solche Kritik richtet sich nicht gegen Individuen, sondern gegen normative Systeme. Es ist daher möglich, Muslime als Personen zu respektieren und zugleich Elemente der klassischen islamischen Lehre kritisch zu prüfen, die Frauen oder Nichtmuslimen einen ungleichen rechtlichen Status zuweisen (z. B. die Dhimmi-Regelungen im klassischen Fiqh; vgl. Koran). Derselbe kritische Maßstab gilt für jede religiöse oder säkulare Doktrin.
Gleiche Rechte sind keine natürliche Gegebenheit, sondern eine fragile intellektuelle und politische Errungenschaft der Aufklärung. Ihr Erhalt erfordert fortwährende philosophische Reflexion und moralische Wachsamkeit.

