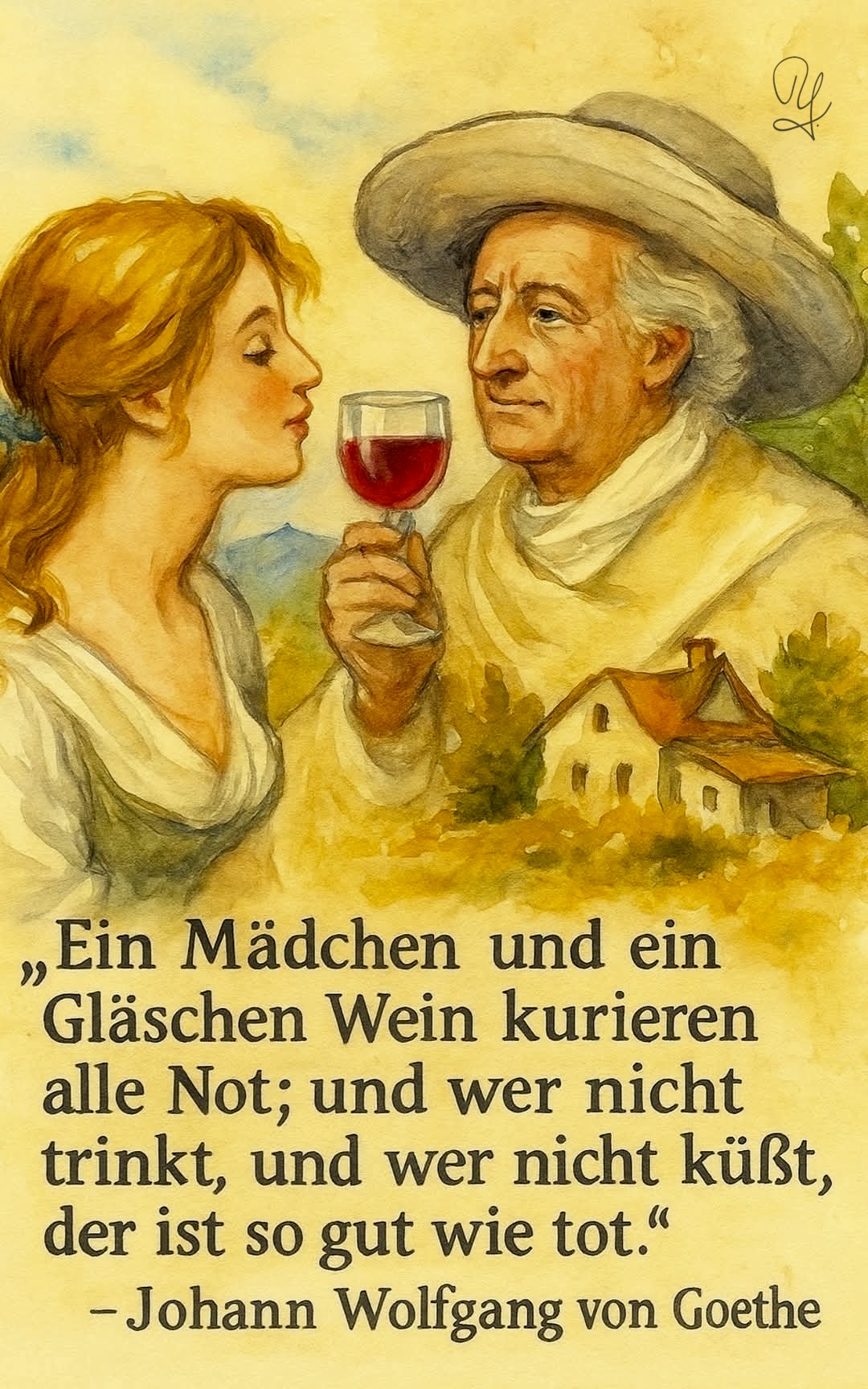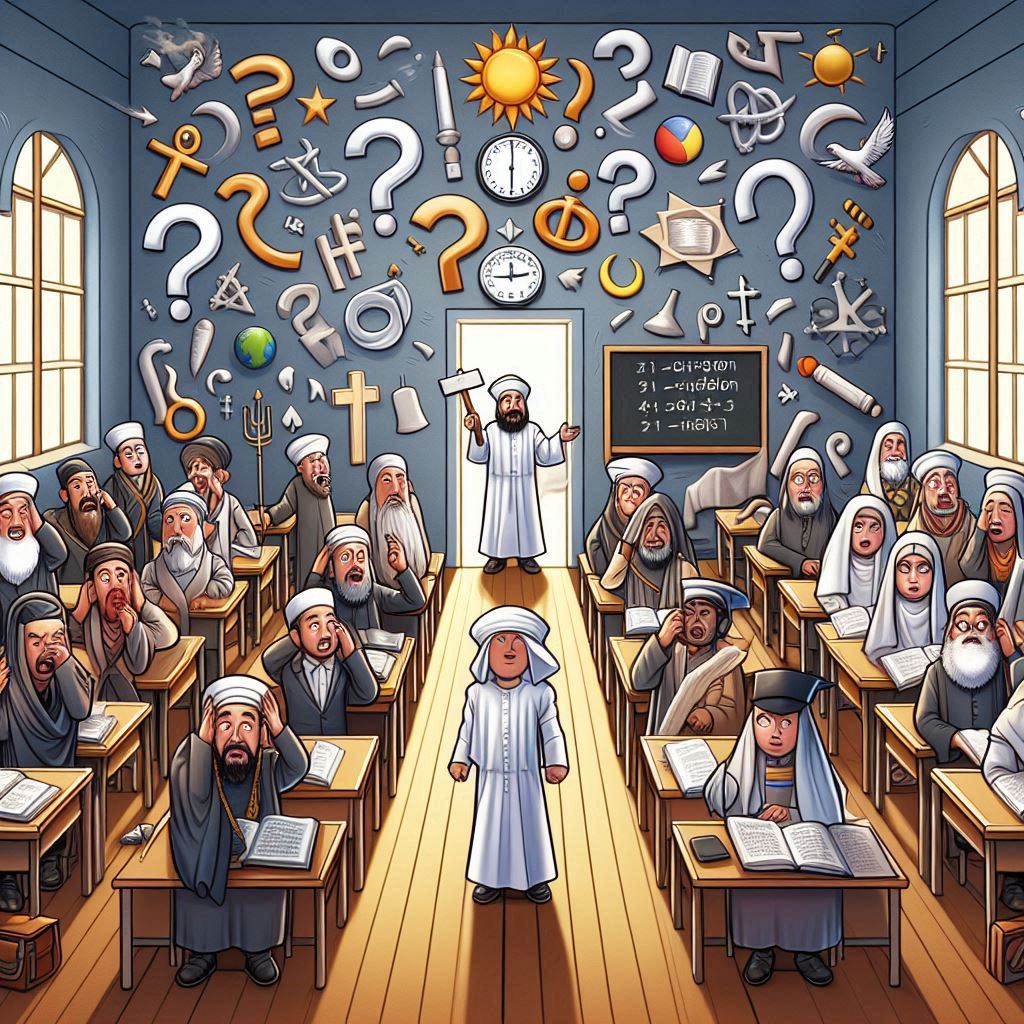Herrscher mit göttlicher Legitimation?

Die Könige des christlichen Abendlandes beriefen sich zur göttlichen Legitimation ihrer Herrschaft auf eine Stelle im Brief des Apostels Paulus an die Römer Röm. 13:1-2: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.“
Beispiele für abgeschaffte oder stark reduzierte Formen des Gottesgnadentums:
Früher waren praktisch alle christlichen Monarchien Europas („von Gottes Gnaden“ auf Münzen und Urkunden). Heute sind sie weitgehend säkularisiert.
Die Monarchen von Dänemark (protestantisch-episkopal), Liechtenstein (katholisch), Monaco (katholisch), der Niederlande (reformiert) und des Vereinigten Königreichs (anglikanisch-episkopal) führen in ihrem großen Titel bis heute den Zusatz „von Gottes Gnaden“.
Dabei stellt sich die Frage: Warum sollte eine Familie das erbliche Recht haben, das Staatsoberhaupt zu stellen?
Die brutalsten abendländischen Herrscher, die sich “Könige von Gottes Gnaden” nannten
Ludwig XIV. von Frankreich („der Sonnenkönig“) Herrschaft „von Gottes Gnaden“ beansprucht. Absolutist, führte viele Kriege, unterdrückte Protestanten (Widerruf des Edikts von Nantes). Brutalität v.a. in Repression und Kriegspolitik.
Philipp II. von Spanien: Eiserner Katholik, verfolgte Protestanten (Inquisition, Niederlande-Aufstand). Anspruch: Gottgegebene Herrschaft. Brutale Unterdrückung der Aufstände in den Niederlanden.
Iwan IV. „der Schreckliche“ von Russland. Zar „von Gottes Gnaden“. Bekannter für seine grausame Unterdrückung (Opritschnina, Massaker von Nowgorod). Extrem brutale Herrschaftsform.
Karl V. (HRR, Spanien) Führte viele Kriege im Namen des Katholizismus. Verfolgung der Reformation. Weniger „blutrünstig“ als andere auf dieser Liste, aber er ergriff durchaus harte Maßnahmen im Namen Gottes.
Ferdinand II. Treibende Figur im Dreißigjährigen Krieg. Rekatholisierung mit Gewalt, Krieg als Gottes Werk interpretiert.
Heinrich VIII. von England Monarch „von Gottes Gnaden“. Exekutionen politischer Gegner, brutale Niederschlagung von Aufständen.
Die spanischen Kolonialherren allgemein herrschten „im Namen Gottes“ über Amerika. Extreme Gewalt gegen indigene Völker.
Auch heute legitimieren sich noch einige Herrschaften mit Gott
Dabei stellen sich Fragen: Welcher Gott ist der richtige und wo ist er überhaupt? Hat es ihn jemals wirklich gegeben?
Explizit religiös legitimiert („von Gottes Gnaden“ betrachten sich die Herrscher von:
Saudi-Arabien: Die Könige führen den Titel „Hüter der heiligen Stätten“. Ihre Legitimation beruht auf dem Wahhabismus und der religiösen Rolle als Verteidiger des Islams.
Iran: Der oberste Führer (Rahbar) hat religiöse Autorität, legitimiert durch das Prinzip der velayat-e faqih (Herrschaft des islamischen Rechtsgelehrten). Das ist eine theokratische Herrschaftsideologie.
Vatikanstadt: Der Papst gilt als Stellvertreter Christi auf Erden. Seine Herrschaft ist eindeutig religiös begründet.
Monarchien mit religiöser / halbreligiöser Symbolik (weniger „hart“): Vereinigtes Königreich: Der britische Monarch wird als „von Gottes Gnaden“ gekrönt und ist Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Sehr formell-symbolisch heute, keine theokratische Herrschaft.
Thailand: Der König gilt traditionell als Devaraja (Gottkönig) oder Bodhisattva-ähnliche Figur. Auch heute noch wird der König religiös verehrt, hat aber keine absolute Macht mehr.
Japan: Der Tenno (Kaiser) war bis 1945 göttlich (Abstammung von Sonnengöttin Amaterasu). Heute offiziell „Symbol des Staates“, die Göttlichkeit wird nicht mehr politisch beansprucht, ist aber kulturell präsent.
Marokko: Der König gilt als „Amir al-Mu’minin“ (Fürst der Gläubigen), religiös legitimiert durch Abstammung vom Propheten.
Äthiopien bis 1974: Der Kaiser galt als „Löwe von Juda“, direkter Nachfahre von Salomo und der Königin von Saba.
Herrscher der Weltgeschichte, die ihre Legitimität von Gott herleiteten
- Rom: Caesar stammte angeblich von der Göttin Venus (über Äneas) ab. Augustus: Wurde nach dem Tod vergöttlicht. Tote römische Kaiser wurden oft zu Göttern erklärt, manche fühlten sich schon zu Lebzeiten als Götter und führten sich auch so auf. Nero, Caligula, Domitian, Hadrian, Elagabal…
- China – Mandat des Himmels (天命, Tiānmìng) Dynastien: Zhou bis Qing (ca. 1046 v.u.Z. – 1912 u.Z.) Idee: Der Kaiser herrscht, weil der Himmel (Tian), eine höchste moralische Instanz, ihm das Mandat gibt. Besonderheit: Das Mandat kann entzogen werden, wenn der Herrscher tyrannisch oder unfähig ist (Naturkatastrophen galten oft als Zeichen dafür).
- Ägypten – Pharaonen als Götter oder Göttersöhne, Zeitraum: ca. 3000 v.u.Z. – 30 v.u.Z. Idee: Die Pharaonen galten entweder als Inkarnationen von Göttern (z. B. Horus) oder als ihre direkten Nachkommen. Zweck: Diente der Rechtfertigung absoluter Herrschaft und zentraler religiöser Rolle.
- Japan – Tennō (天皇, Kaiser von Japan) als Nachfahre der Sonnengöttin Amaterasu. Idee: Der Kaiser leitet seine Abstammung direkt von der Shintō-Göttin Amaterasu ab. Folge: Bis 1945 galt der Tennō als lebender Gott. Heute: Die Verfassung von 1947 entzieht ihm formale politische Macht, aber die göttliche Abstammung ist kulturell noch präsent.
- Inka – Sapa Inka als Sohn der Sonne. Idee: Der Inka-Kaiser war der direkte Sohn der Sonnengottheit Inti. Folge: Religiöse und politische Macht verschmolzen vollständig.
- Islamische Herrscher – Kalifen, Imame und Mahdis Kalifen (z. B. Umayyaden, Abbasiden) Gaben vor, Nachfolger des Propheten Muhammad zu sein – nicht göttlich, aber religiös legitimiert.
Schiitischer Islam: Die Zwölf Imame gelten als unfehlbar und von Gott bestimmt.
Mahdi-Figuren: In verschiedenen Bewegungen (z. B. im Sudan) wurden Herrscher als gottgesandte Erlöser angesehen.
- Indien – Göttliche Königtümer (Devaraja-Konzept) Besonders in Südostasien (z. B. Khmer-Reich) Devaraja: Der König ist entweder eine Inkarnation eines Gottes (z. B. Vishnu, Shiva) oder wird nach dem Tod göttlich verehrt. Ziel: Legitimation und Sakralisierung der Macht.
- Afrikanische Königreiche Beispiel: Yoruba-Könige (Obas), Zulu-Könige, äthiopische Kaiser Äthiopien: Herrscher der Salomonischen Dynastie leiteten ihre Abstammung direkt von König Salomo und der Königin von Saba ab. Zulu-Könige: Wurden häufig mit spiritueller Kraft und göttlichem Auftrag verbunden.
- Maya und Azteken – Theokratische Herrscher Aztekischer Tlatoani: Wurde als Repräsentant der Götter auf Erden verehrt. Maya-Könige: Gaben vor, göttliche Vermittler zu sein, mit Ritualen zur Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung.
Fazit:
Die Idee göttlicher Legitimation ist universell – sie diente in fast allen Kulturen dazu, weltliche Macht zu festigen und zu sakralisieren. Je nach Religion, Weltbild und Kultur variierte jedoch die Form: mal als Sohn Gottes, mal als Auserwählter des Himmels, mal als Inkarnation eines Gottes.
Nachteile: Entrechtung des Volkes – Willkürherrschaft – Keine Machtkontrolle
Eine Herrschaft, die sich göttlich legitimiert fühlt, bringt erhebliche Nachteile mit sich. Hier sind die wichtigsten:
- Kritik ist Sakrileg – keine Kontrolle der Macht. Problem: Wenn der Herrscher als Gott oder Gottes Auserwählter gilt, wird Kritik zur Gotteslästerung. Folge: Keine freie Meinungsäußerung, kein Raum für politische Opposition oder Reformen.
- Unfehlbarkeitsanspruch führt zu Starrheit. Konsequenz: Göttlich legitimierte Herrscher sehen sich oft als unfehlbar oder vom Schicksal bestimmt. Risiko: Selbst offensichtliches Scheitern wird nicht anerkannt – Reformen gelten als Misstrauen gegen den „Willen Gottes“.
- Machtwechsel wird zur Krise Warum? Wenn Macht durch göttliche Abstammung oder Erwählung legitimiert ist, wird jeder Wechsel zur Infragestellung göttlicher Ordnung. Folge: Bürgerkriege, religiöse Spannungen oder Zusammenbruch des Staates bei Thronstreitigkeiten.
- Stillstand statt Fortschritt Grund: Religiös sanktionierte Systeme neigen dazu, überkommene Traditionen zu konservieren. Beispiel: Wissenschaft, Menschenrechte oder neue Gesellschaftsmodelle können als „gotteswidrig“ gebrandmarkt werden.
- Instrumentalisierung der Religion. Ergebnis: Die Religion wird zur Machtstütze des Herrschers – nicht zur spirituellen Orientierung der Gemeinschaft. Gefahr: Geistliche Führer verlieren ihre Unabhängigkeit, werden zu Funktionären der Macht.
- Legitimationskrisen bei Katastrophen oder Niederlagen. Beobachtung: Naturkatastrophen, Hungersnöte oder Kriegsniederlagen stellen die göttliche Legitimation infrage. Folge: Plötzlicher Autoritätsverlust, soziale Unruhen oder radikale Umstürze.
- Ausgrenzung Andersgläubiger Wer nicht an den „richtigen Gott“ glaubt oder das göttliche Mandat des Herrschers nicht anerkennt, gilt als Feind.
Folge: Verfolgung, Diskriminierung, Religionskriege.
Eine göttlich legitimierte Herrschaft ist autoritär, unflexibel und gefährlich für die Freiheit und Pluralität einer Gesellschaft. Die Verbindung von Religion und absoluter Macht führt oft dazu, dass Irrtümer nicht korrigiert, sondern vergöttlicht werden.
Der Weg zur Befreiung
Europa hat sich nicht über Nacht, sondern in einem langen, konfliktreichen Prozess von der Herrschaft der Könige „von Gottes Gnaden“ befreit.
Die Idee, dass die Staatsgewalt von der Zustimmung der Regierten abhängig sein sollte, kam im antiken Athen auf und wurde dort von etwa 508 v.u.Z. bis 322 v.u.Z. mit Unterbrechungen von den wahlberechtigten Bürgern praktiziert. Sklaven, Frauen und Fremde waren nicht wahlberechtigt.
Es war eine komplexe Mischung aus Ideen, Krisen, Aufständen und politischen Veränderungen, die die göttlich legitimierte Monarchie Schritt für Schritt ablöste. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Etappen:
Ideengeschichte – Das Ende des göttlichen Absolutismus beginnt im Kopf und in den Stadtstaaten des antiken Griechenlands.
1525 Reformation und Bauernkrieg in Europa. Die absolute Herrschaft von Kirche und Adel wurde durch die Reformation gebrochen.
Die “Memminger Forderungen” der Bauern wurden zwar nicht durchgesetzt, wiesen aber als Vorbild in die Zukunft.
Aufklärung (17.–18. Jahrhundert)
Kernidee: Vernunft statt göttlicher Offenbarung als Grundlage für die Politik.
Denkende Wegbereiter waren John Locke; Volkssouveränität, Recht auf Widerstand;
Montesquieu: Gewaltenteilung; Rousseau: Gesellschaftsvertrag
Folge: Wachsende Zweifel an der Legitimation durch Gott. Der Mensch selbst wird als Träger politischer Rechte verstanden. Wenn wir keine gerechte Welt schaffen, wird es keine geben.
Konflikte und Revolutionen – Wenn Gedanken zu Handlungen werden.
Englische Revolution (1640–1689) Resultat: König Karl I. wird hingerichtet, Parlamentarismus setzt sich schrittweise durch.
Wendepunkt: Die „Glorious Revolution“ (1688) etabliert eine konstitutionelle Monarchie in England. Der König regiert nicht mehr „von Gottes Gnaden“, sondern mit Zustimmung des Parlaments.
Französische Revolution (1789) Sprengkraft: Der Glaube an göttlich eingesetzte Monarchen wird radikal zurückgewiesen. Folgen: Ende der Bourbonenmonarchie. Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte. Geburtsstunde moderner Republik-Ideen in Europa.
Verfassungen und Säkularisierung 19. Jahrhundert: Verfassungsbewegungen in ganz Europa. Monarchen verlieren zunehmend die absolute Macht. Die Bürgerliche Revolution von 1848 wurde in Deutschland zwar niedergeschlagen, aber die Ideen von einer Verfassung und von Bürgerrechten blieben bestehen.
Neue Staaten (z. B. Italien, Deutschland) erhalten Verfassungen – oft mit beschränkter monarchischer Rolle.
Trennung von Kirche und Staat
Säkularisierung schreitet voran (z. B. Frankreich 1905: Laizismus per Gesetz).
Religion wird Privatsache, sie ist nicht mehr Grundlage staatlicher Autorität.
Zäsur durch den Ersten Weltkrieg (1914–1918)
Monarchien stürzen: Deutschland (Kaiser Wilhelm II. abgesetzt, 1918) Österreich-Ungarn (Zusammenbruch, 1918) Russland (Zar Nikolaus II. wird 1917 gestürzt).
Die „Gottgesandten“ verlieren ihre Throne.
Demokratie als neues Legitimationsprinzip
Volkssouveränität ersetzt die göttliche Gnadenwahl.
Wahlen, Verfassungen und Grundrechte bilden die neue Ordnung.
In vielen Ländern Europas sind Monarchen heute nur noch symbolisch – ohne politische Macht.
Fazit:
Die Befreiung Europas von der Herrschaft der Könige „von Gottes Gnaden“ war kein einziger Umsturz, sondern ein langes Ringen zwischen Kirche und Staat, König und Volk, Tradition und Aufklärung. Sie gelang durch Bildung und kritisches Denken, mutige Revolutionen, institutionelle Reformen, sowie eine allmähliche Trennung von religiöser und politischer Macht. Europa wurde damit politisch säkular – und öffnete den Weg für moderne Demokratien ohne göttliche Legitimation.
_____________________
Kurze Zusammenfassung
Herrschaft „von Gottes Gnaden“ – historische Formen, Kritik und Ablösung
1. Biblische Grundlage
- Römer 13,1–2:
„Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet …“
- Begründung: Widerspruch gegen die Obrigkeit = Widerspruch gegen Gottes Ordnung.
2. „Von Gottes Gnaden“ in Europa
2.1 Früher
- Fast alle christlichen Monarchien Europas führten den Titel „von Gottes Gnaden“ (auf Münzen, Urkunden).
- Legitimation: Gott habe ihnen angeblich die Herrschaft verliehen.
2.2 Heute
- Meist säkularisiert.
- Nur symbolisch erhalten, z. B. im Titel:
- Dänemark (protestantisch-episkopal)
- Liechtenstein (katholisch)
- Monaco (katholisch)
- Niederlande (reformiert)
- Vereinigtes Königreich (anglikanisch-episkopal)
Kritische Frage: Warum sollte eine Familie ein „erbliches Recht“ auf das Amt des Staatsoberhaupts haben?
3. Beispiele brutaler Herrscher „von Gottes Gnaden“
- Ludwig XIV. (Frankreich)
- Absolutist, Widerruf Edikt von Nantes → Unterdrückung Protestanten.
- Philipp II. (Spanien)
- Inquisition, Aufstand in den Niederlanden blutig niedergeschlagen.
- Iwan IV. „der Schreckliche“ (Russland)
- Grausame Unterdrückung, Massaker von Nowgorod.
- Karl V. (HRR, Spanien)
- Ferdinand II.
- Dreißigjähriger Krieg, gewaltsame Rekatholisierung.
- Heinrich VIII. (England)
- Exekution politischer Gegner.
- Spanische Kolonialherren
- Gewaltsame Missionierung und Unterdrückung indigener Völker.
4. Heute noch religiös legitimierte Herrschaften
4.1 Explizit religiös
- Saudi-Arabien
- „Hüter der heiligen Stätten“.
- Legitimation: Wahhabismus.
- Iran
- Oberster Führer mit religiöser Autorität (velayat-e faqih).
- Vatikanstadt
- Papst als Stellvertreter Christi.
4.2 Mit religiös-symbolischer Legitimation
- Vereinigtes Königreich
- Monarch/in als Oberhaupt der Anglikanischen Kirche.
- Thailand
- König als Devaraja (Gottkönig-ähnliche Verehrung).
- Japan
- Kaiserliche Abstammung von der Sonnengöttin Amaterasu.
- Marokko
- König als „Amir al-Mu’minin“ (Fürst der Gläubigen).
- Äthiopien (bis 1974)
- Kaiser als Nachfahre Salomos und der Königin von Saba.
5. Göttliche Legitimation weltweit (historische Beispiele)
5.1 China
- Mandat des Himmels (Tiānmìng)
- Himmel verleiht Legitimation → kann aber bei schlechter Herrschaft entzogen werden.
5.2 Ägypten
- Pharaonen als Götter oder Göttersöhne.
5.3 Japan
- Kaiser als Nachfahre Amaterasus → bis 1945 als Gottkaiser verehrt.
5.4 Inka-Reich
- Sapa Inka = Sohn der Sonne (Inti).
5.5 Islamische Herrscher
- Kalifen: Nachfolger des Propheten (nicht göttlich, aber religiös legitimiert).
- Schiitische Imame: von Gott bestimmt und unfehlbar.
- Mahdi-Bewegungen: gottgesandte Erlöser.
5.6 Indien / Südostasien
- Devaraja-Konzept:
- König als Inkarnation eines Gottes (z. B. Vishnu, Shiva).
5.7 Afrika
- Yoruba-Könige, Zulu-Könige, äthiopische Kaiser.
- Kombination von weltlicher und spiritueller Macht.
5.8 Mesoamerika
- Azteken: Tlatoani als Repräsentant der Götter.
- Maya-Könige: göttliche Vermittler.
6. Kritik an göttlicher Legitimation
- Entrechtung des Volkes
- Kritik = Sakrileg
- Keine Meinungsfreiheit, keine Opposition möglich.
- Unfehlbarkeitsanspruch
- Keine Reformen, keine Lernprozesse.
- Krisen bei Machtwechsel
- Thronstreitigkeiten, Bürgerkriege.
- Stillstand statt Fortschritt
- Wissenschaft und Menschenrechte als Bedrohung gebrandmarkt.
- Instrumentalisierung der Religion
- Religion als Machtstütze.
- Legitimationskrisen
- Naturkatastrophen, Niederlagen → Autoritätsverlust.
- Ausgrenzung Andersgläubiger
- Diskriminierung, Verfolgung, Religionskriege.
7. Europas Weg aus der göttlichen Legitimation
7.1 Ideengeschichte
- 1525: Reformation und Bauernkrieg → Beginn der Kritik.
- Aufklärung (17.–18. Jh.)
- John Locke: Volkssouveränität, Widerstandsrecht.
- Montesquieu: Gewaltenteilung.
- Rousseau: Gesellschaftsvertrag.
- → Vernunft statt göttlicher Offenbarung.
7.2 Revolutionen und politische Umbrüche
- Englische Revolution (1640–1689)
- Parlamentarismus, „Glorious Revolution“ → konstitutionelle Monarchie.
- Französische Revolution (1789)
- Ende des Glaubens an göttlich eingesetzte Könige.
- Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte.
7.3 Verfassungen und Säkularisierung
-
- Jh.: Trennung von Kirche und Staat.
- Monarchen verlieren absolute Macht.
- Laizismus in Frankreich (1905).
7.4 Erster Weltkrieg als Zäsur
- Sturz vieler Monarchien:
- Deutschland, Österreich-Ungarn, Russland.
- Demokratie ersetzt Gottesgnadentum.
8. Fazit
- Göttliche Legitimation diente überall zur Festigung weltlicher Macht.
- Nachteile: Machtmissbrauch, fehlende Kontrolle, Stillstand, Verfolgung.
- Europas Befreiung:
- Bildung, Aufklärung, Revolutionen, Reformen.
- Trennung von Religion und Staat.
- Ergebnis: Moderne Demokratie auf Basis von Volkssouveränität und Menschenrechten.